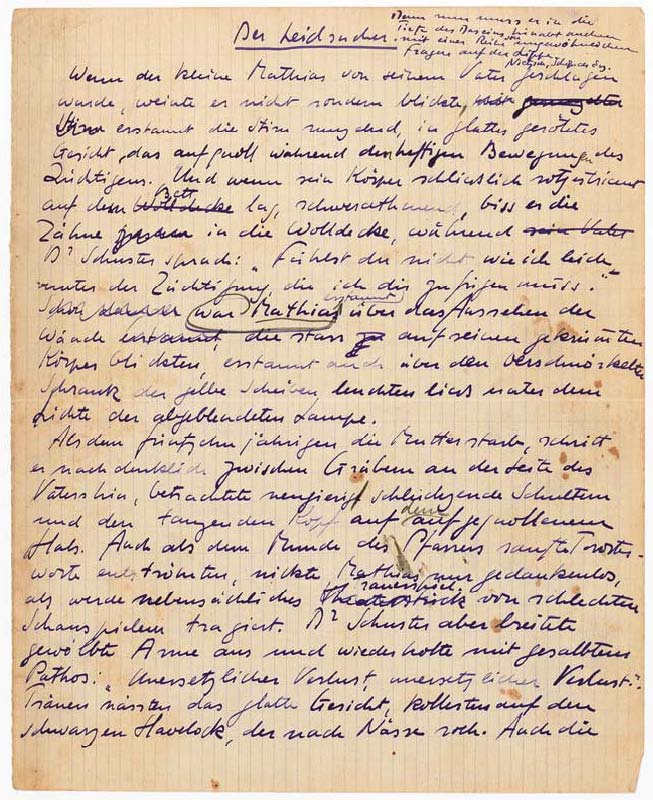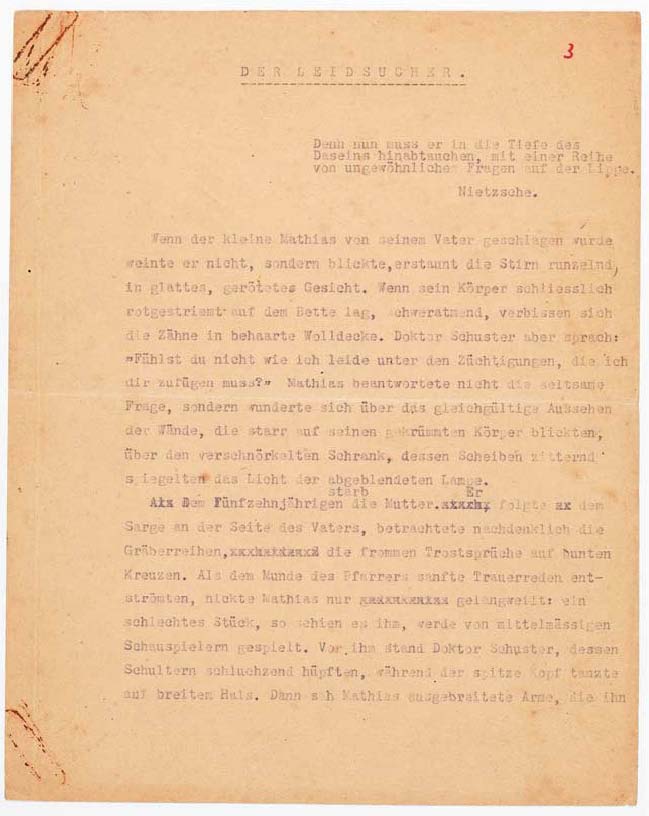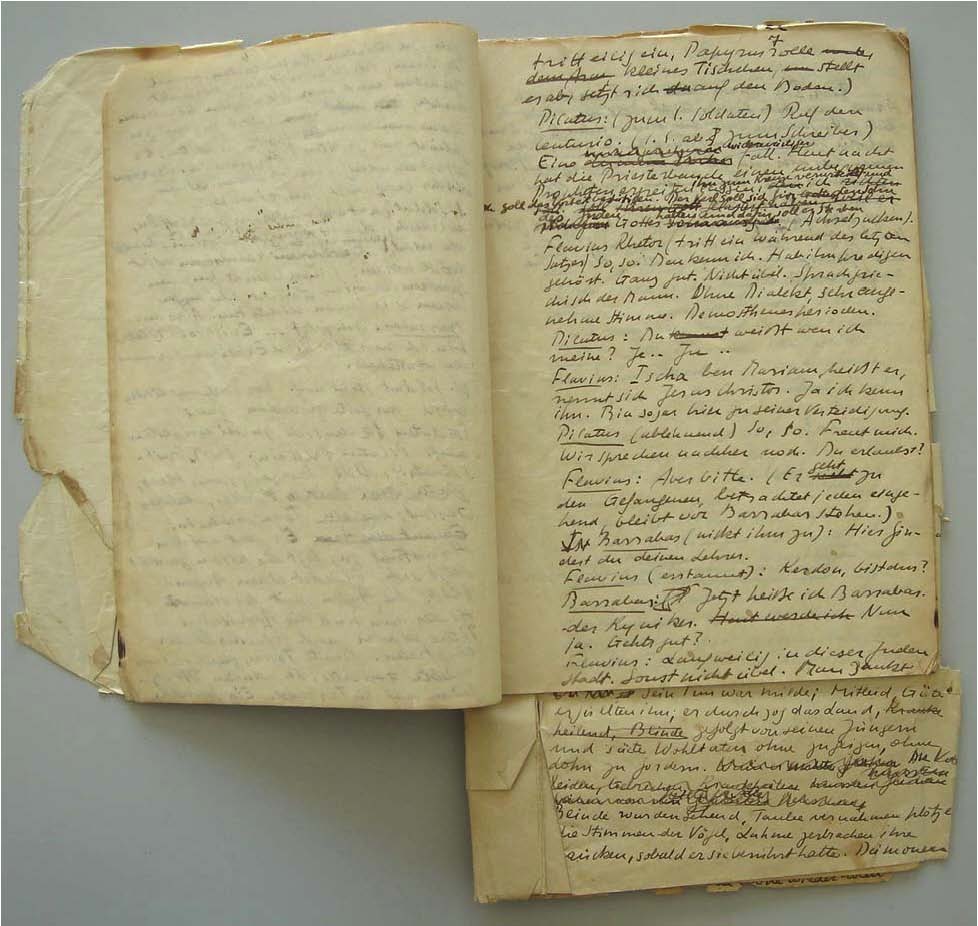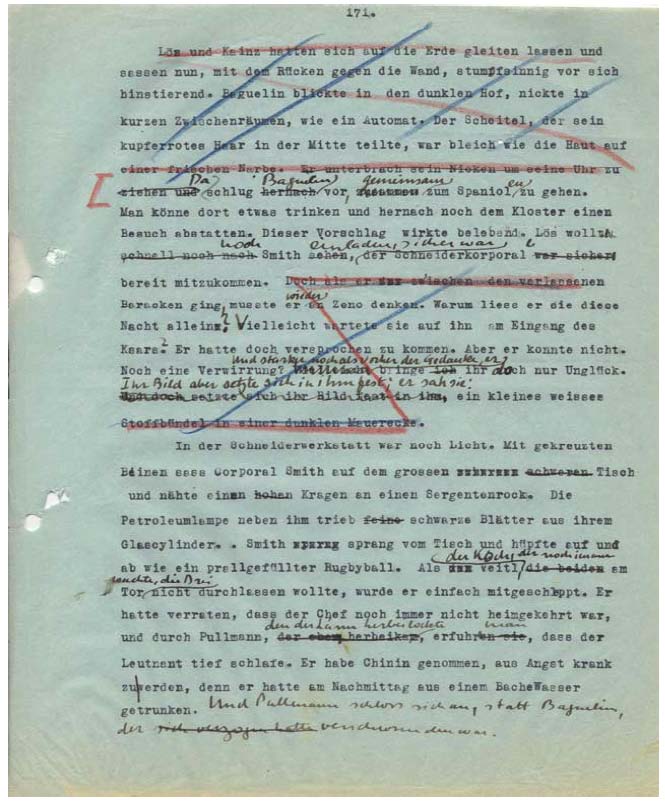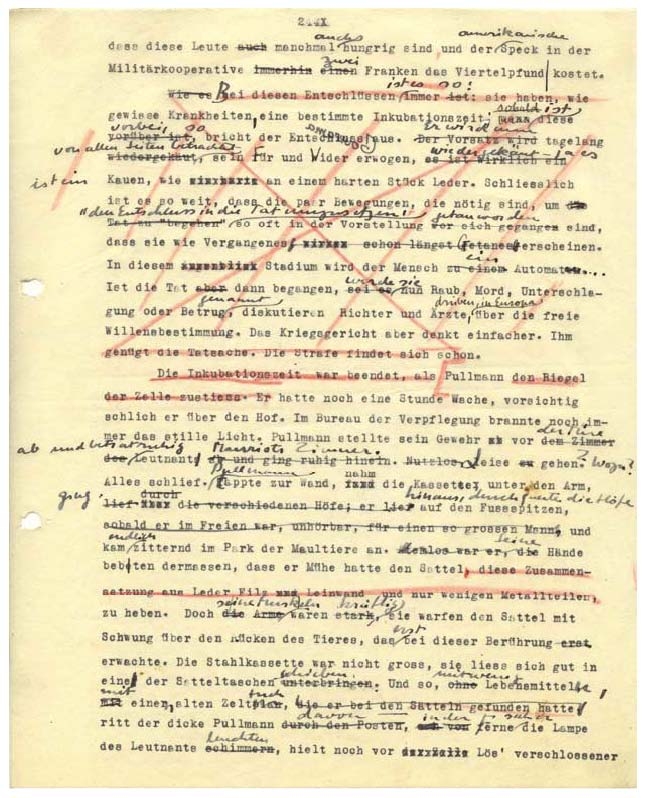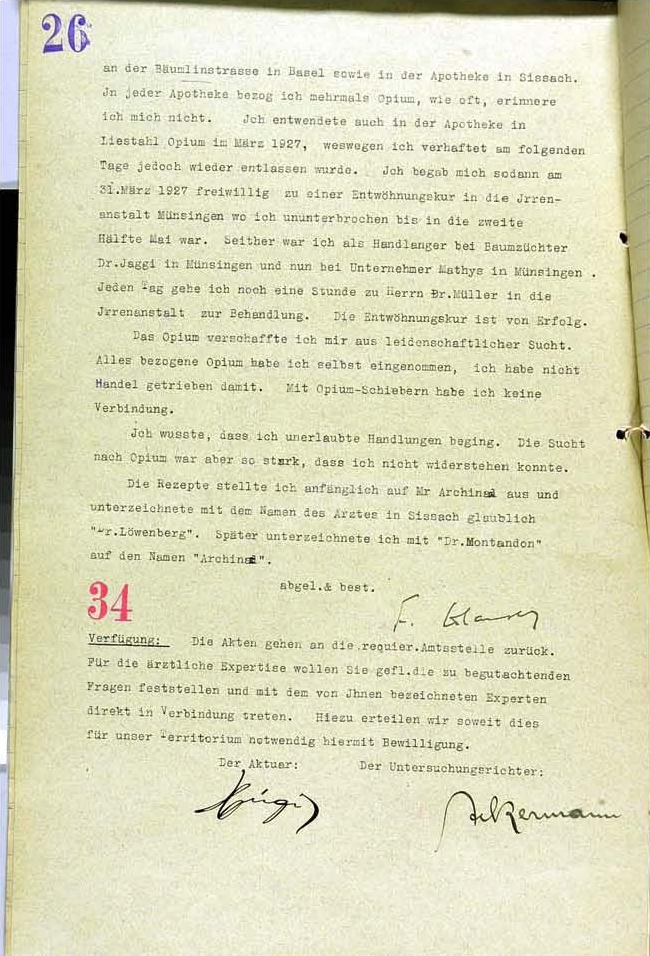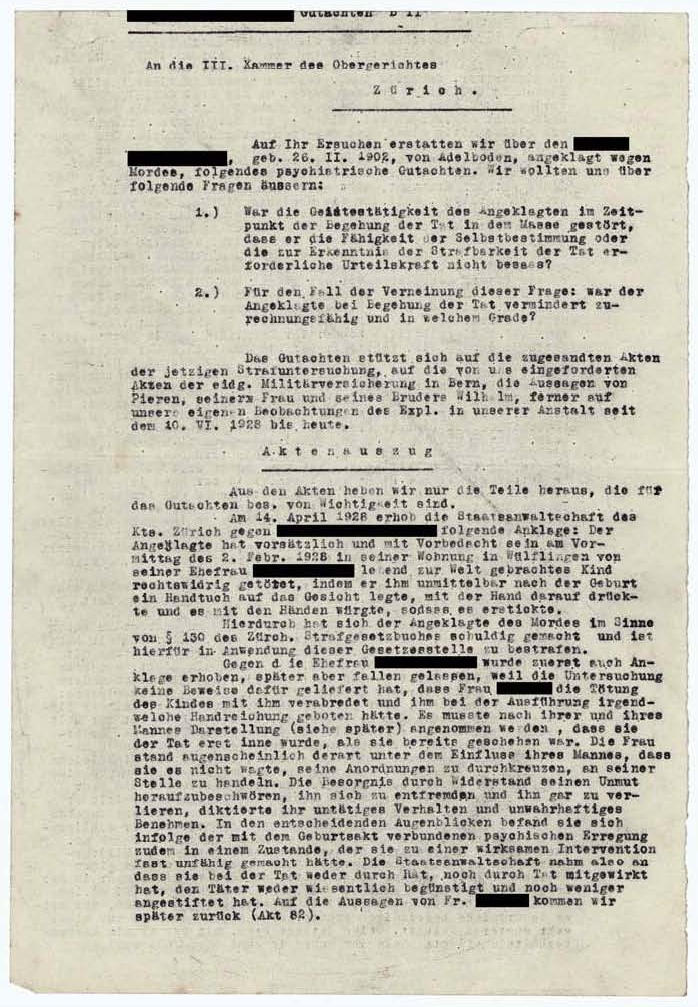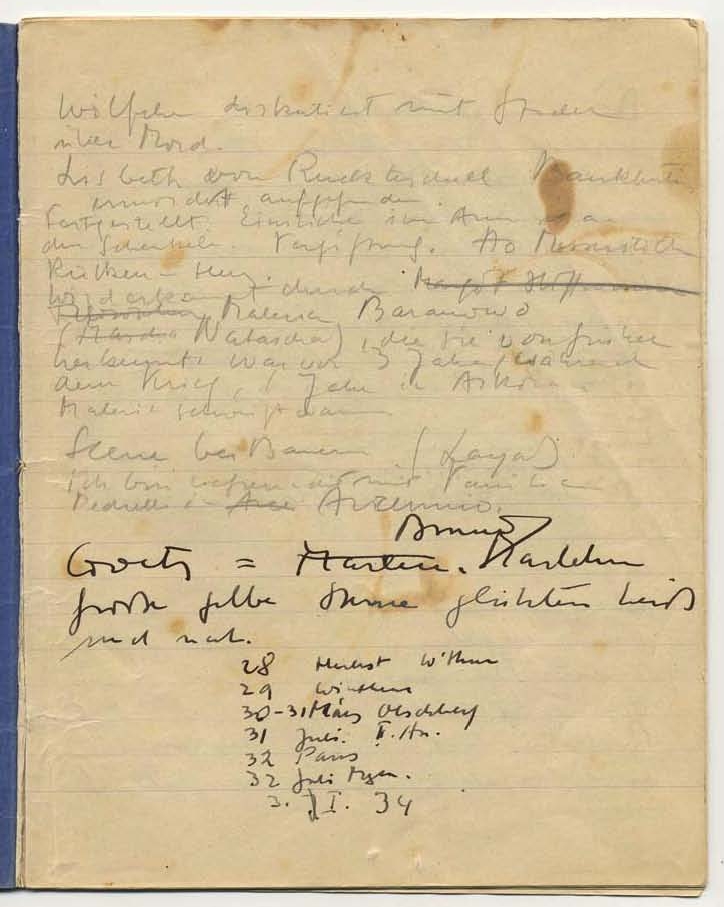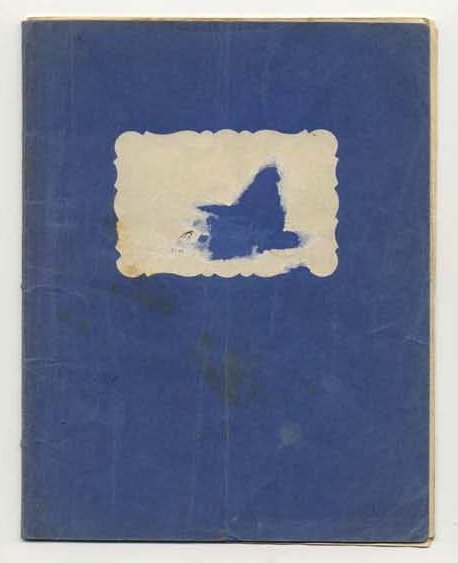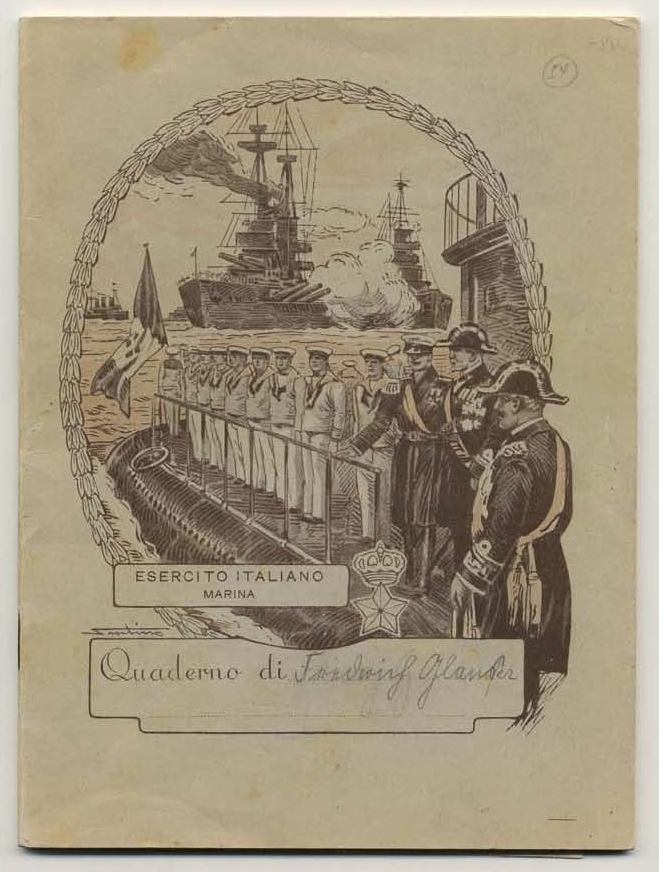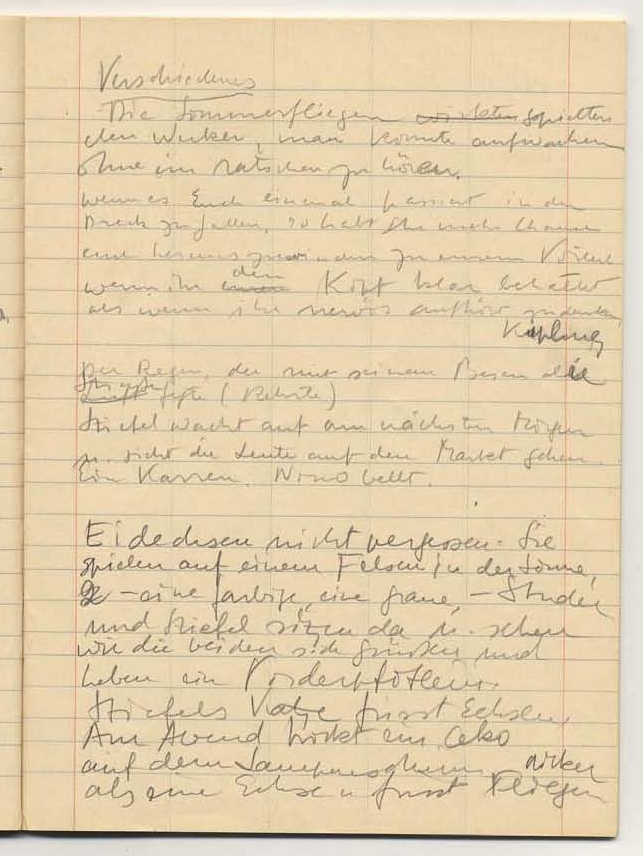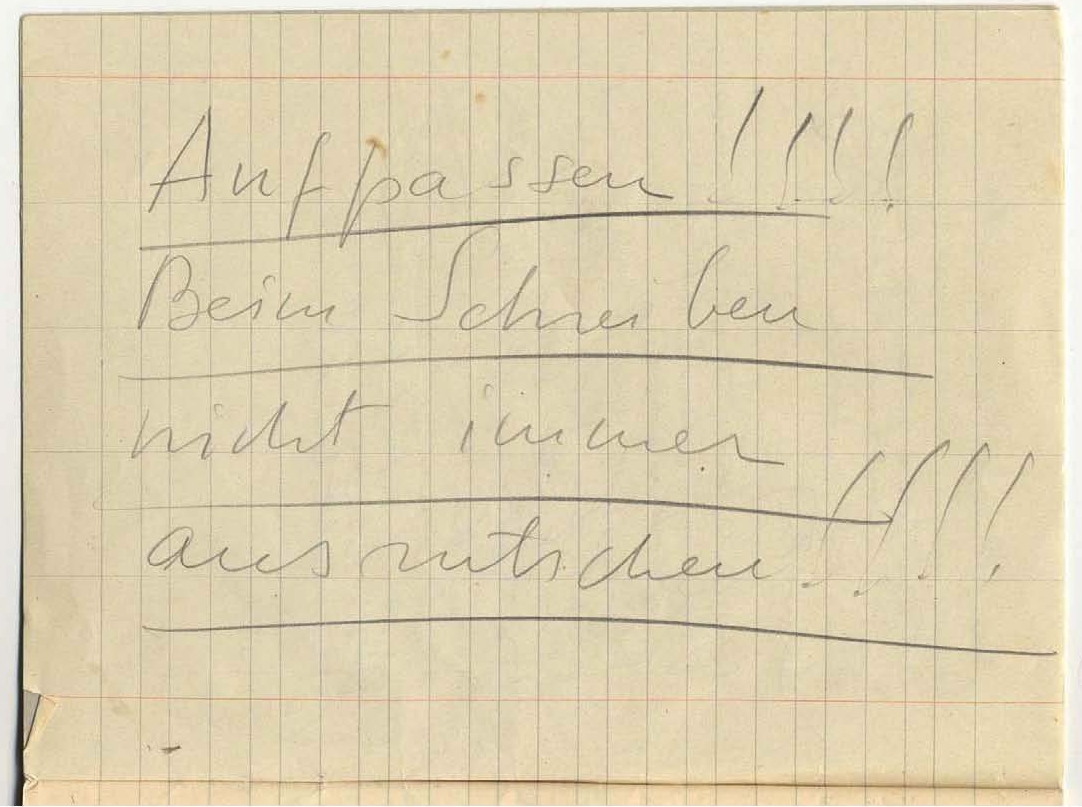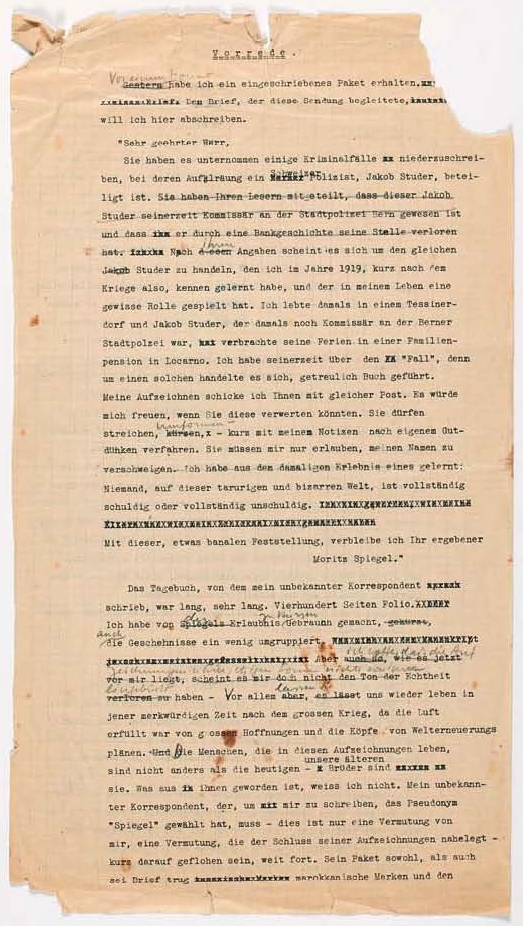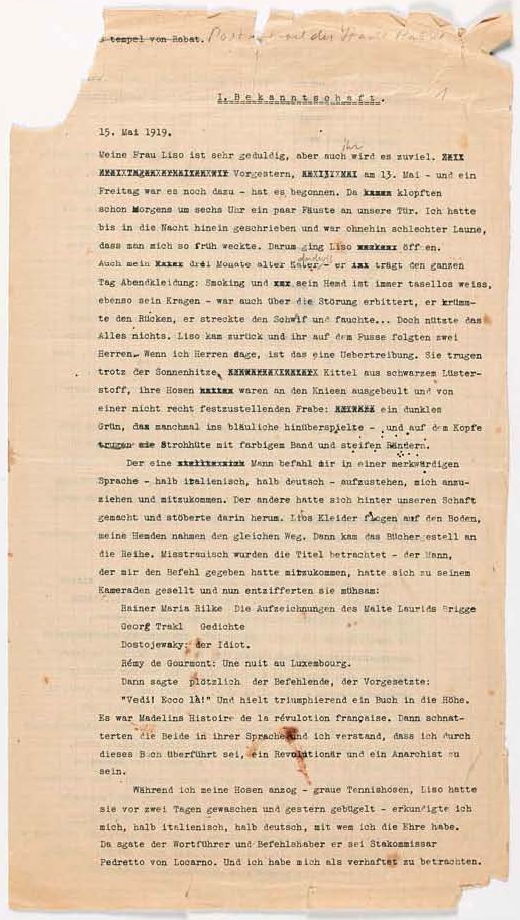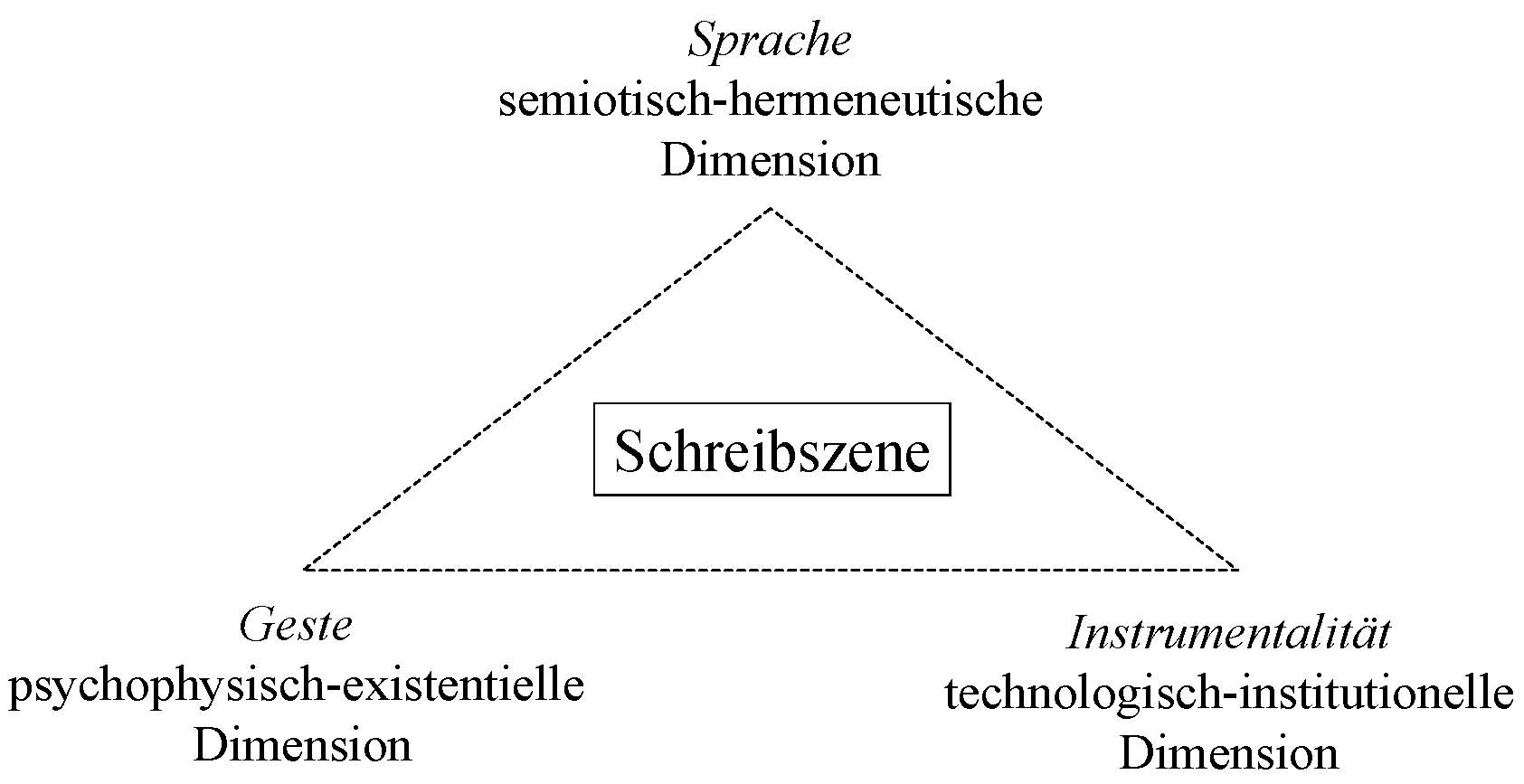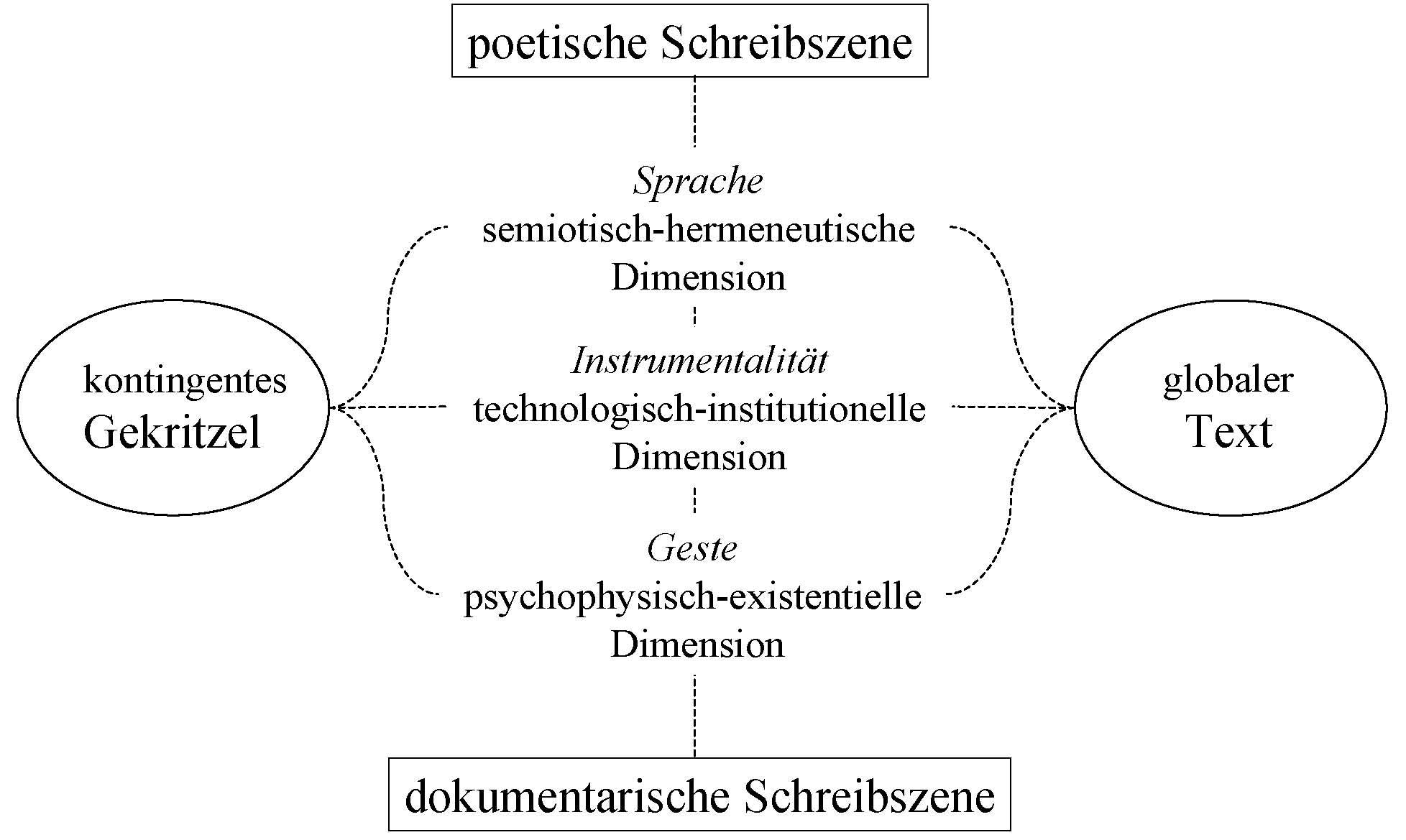Friedrich Glausers Schreiben im Kreuzungspunkt
von Philologie und Kulturwissenschaft
Im Spätsommer 1937 hat Friedrich Glauser für die Zürcher
Illustrierte, damals die führende Wochenzeitschrift, einen Text mit dem
Titel Schreiben... verfaßt (Abb. 1). Es war ein expliziter Auftrag
aus gegebenem Anlaß: Der Text sollte Ende November den Abdruck des dritten
(aber als zweiten verfaßten) Wachtmeister Studer-Romans Die Fieberkurve
ab der nächsten Nummer mit einer Selbstpräsentation
des Autors ankündigen. Das war nicht nichts für einen Autor, der bis Mai 1936 in der
Irrenanstalt Waldau interniert gewesen war; tatsächlich befand er sich, nach
dem Erfolg seiner beiden vorangehenden Studer-Romane, Schlumpf Erwin
Mord (1935/36) und Matto regiert (1936), bereits auf dem Höhepunkt seiner Karriere,
wenn man das so nennen mag.1
Denn die Umstände seiner Existenz hatten sich nur
kurzfristig verbessert. Gerade die Vermehrung der Aufträge, deren Bezahlung
doch immer zu gering für eine Existenzsicherung blieb, schienen ihn, zusammen
mit der Drogensucht, in die Spirale der Überforderung und immer neue
Erschöpfungszustände zu treiben. Im Herbst 1938 gerieten er und seine Freundin
Berthe in Nervi, wo sie heiraten wollten, gar in eine Notlage. Davon zeugen Briefe,
die den Ton der Verzweiflung nur schlecht meistern. Glauser kollabierte am 6.
Dezember 1938, einen Tag vor der Heirat, und starb zwei Tage darauf.

Abb. 1.: Friedrich Glauser (1937): "Schreiben..."
Zürcher Illustrierte 48: 1514.
Bestellt hatte Friedrich Witz, damals Redakteur bei der Zürcher Illustrierten,
einen Text für eine "große Ankündigung des Romans mit: 'Wie begann
der Autor zu schreiben', mit Lebenslauf", so referiert Glauser aus der Bretagne
brieflich.2 Erhalten
hat Witz einen "Artikel"3
zur "Einführung"; den Lebenslauf konnte Glauser ihm ausreden: "Es
ist doch unnötig, daß ich die Leser der 'Z. I.' über alle Schandtaten des
meines an Schandtaten reichen Lebens aufkläre." Die Dreingabe bildeten statt
dessen Erinnerungen an die Originalität des Schülers Glauser von Charly Clerc,
Lehrer im Landerziehungsheim Glarisegg, das Glauser von 1910 bis 1913 besucht hatte.
Glauser nennt den Text, wie gesagt, einen"Artikel", vermutlich, wie auch
anderswo, in Abgrenzung eines nicht-fiktionalen Zeitungstext von einer fiktionalen
"Erzählung" oder "Novelle". Der Text Schreiben...
geht ebenso von autobiographischen Fakten aus, wie er damit dann frei umgeht.
Erzählendes Ich und erlebendes Ich fallen im Eigennamen des Autor-Erzählers und
des Protagonisten zusammen. Allerdings kommt der Autorname nur einmal vor, als
der junge Protagonist, Gymnasiast am Collège de Genève, vor den dort lehrenden
Professor Frank Grandjean tritt und sagt: "Ich möchte mich entschuldigen,
Herr Professor... [...]. Mein Name ist Glauser, ich habe jenen Artikel verfaßt,
der unter dem Pseudonym 'Pointe-sèche' erschienen ist..." (Glauser 1937b: 82).
Im übrigen wird der Protagonist stets "Monsieur Glosère" genannt und
im Text nach der französischen Phonetik ausbuchstabiert.
Was sich darin also um das bereits verratene factum brutum herum begibt, werde
ich Ihnen nun gleich nacherzählen (I). Anschließend werde ich die
literaturwissenschaftlichen Ansätze aus dem Begriff der Schreibszene in
fünfeinhalb Schritten entwickeln: zunächst theoretisch (II), darauf
poetologisch (III), anhand des Textes Schreiben..., sodann dokumentarisch
oder im engeren Sinn philologisch anhand von Einblicken in den im Schweizerischen
Literaturarchiv befindlichen Nachlaß von Friedrich Glauser; darin gibt es einen
kleineren Zwischenschritt zur Diskursanalyse (das wäre der halbe Schritt)
(IV). Abschließend werde ich noch versuchen, die Frage nach der ethisch-philosophische
Dimension des Schreibens wenigstens aufzuwerfen (V).
I Urszenen des Schreibens
"Die Schulbänke sind alt und verschnitzelt, in der obersten, der ersten
Klasse. Viele Generationen haben die Schärfe ihrer Taschenmesser am weichen Holz
geprüft." So hebt der Text medias in res an und gelangt mit ein paar
Sätzen mitten in eine Griechischlektion. Der Klassenprimus übersetzt aus Platons
Gastmahl einen Satz von Sokrates, der ironische Zweifel an seiner Weisheit
äußert. Professor Dubois nimmt die letzten Worte des Satzes auf und
fährt im selben Ton fort: "Monsieur Glosère, ich erwarte Sie
nach der Stunde. Ich habe Ihnen etwas mitzuteilen." Monsieur Glosère,
wie der Ich-Erzähler den Ich-Protagonisten nun selbst apostrophiert, liest unter
dem Pult Dostojewskis Idiot; das Buch fällt prompt zu Boden, und die letzte
Griechisch-Stunde hat er für ein Psychologie-Seminar geschwänzt. Doch Professor
Dubois ist ihm eigentlich wohl gewogen, und als Monsieur Glosère nach der Lektion
vor ihm steht, weiß er auch, daß es eine andere "Sünde"
ist, die nun zur Sprache kommt (Glauser 1937b: 79).
Durch freundschaftliche Beziehungen hat der Neunzehnjährige Gelegenheit erhalten,
für den Journal helvétique zu schreiben. "Wie schön war
es", schwärmt der Schreiber von den damaligen ersten Schreiberfahrungen,
"Korrektur zu lesen, welches Wunder bedeutete es, die Sätze, die ich
mühsam in einer Algebra-Stunde geschrieben hatte, nun plötzlich gedruckt zu
sehen. Was, ist es möglich, daß die Sätze gedruckt so anders aussehen als
handgeschrieben? Daß ihnen die Druckerschwärze Geist verleiht?..."
(Glauser 1937b: 80).
Tatsächlich – in Klammern korrigiere und ergänze ich hier ein wenig die
Fakten – war es L'Indépendence Helvétique, für die
Glauser von Ende 1915 bis Anfang 1916 in vier Monaten sieben Texte auf französisch
veröffentlicht hatte, neben Rezensionen über Thomas Manns Buddenbrocks
und eine Inszenierung von Ibsens Hedda Gabler auch über heute unbekannte
Autoren und eine Novelle mit dem Titel Nouvelle. Unter den unbekannteren Autoren
war Frank Grandjean, Professor am Collège, aber nicht Glausers Lehrer, der neben
einem Buch über Bergson nun ein dichterisch-philosophisches Werk mit dem Titel
Der Sang des Einzelgängers, so übersetzt der Autor-Erzähler
Glauser den Titel L'Épopée du Solitaire, veröffentlicht
hat (Grandjean o. J.). Es handelt sich um ein zweihundertseitiges Epos
in philosophisch von Platon bis Nietzsche inspirierten und poetisch von Petronius bis
Mallarmé geklitterten Alexandrinern, das Glauser unter dem Titel Un
poète philosophe rezensiert hat (Glauser 1915/16).
Nun weiter im Text: "Es war nicht schwer", so beurteilt Glauser mehr als
zwanzig Jahre später die Aufgabe des damaligen Rezensenten Glosère,
nachdem er ein paar Verse zitiert hat. Der Solitaire – ich zitiere –
"spricht viel von sich und idealisiert sich dabei. Bald ist er ein Apoll,
schlank gewachsen, mit klarem Blick aus feurigen Augen, bald ist er ein Weiser
Griechenlands, der [...] moralische Erkenntnisse regnen läßt. Was liegt
näher, als festzustellen, daß Apoll in Wirklichkeit nicht schlankgewachsen,
sondern kugelförmig und dick ist, daß die klaren Blicke verschlafen sind und
die Augen nicht feurig, sondern vorgewölbt. Dies alles", so resümiert
Glauser, "stand, gespickt mit Zitaten aus dem Epos Sang eines Einzelgängers
in dem Artikel, der unterschrieben war: 'Pointe-sèche'" (Glauser
1937b: 80). 'Pointe-sèche', so erklärt Glauser, sei das
"Gerät, das die Radierer brauchen, um direkt auf die Kupferplatte zu
zeichnen", und übersetzt mit "Grabstichel", gebräuchlicher
ist heute wohl das Wort "Kaltnadel" (ebd. und Kommentar dazu: 412f.).
Daß die Vorsichtsmaßnahme des Pseudonyms nichts genutzt hat,
erklärt ihm dann Professor Dubois, nicht ohne ihm zu bedeuten, daß
"Monsieur Glosère", dem er auch Französisch unterrichtete, ihm
stilistisch alle "Ehre machen" würde. Aber hier gehe es nicht um
Stil, sondern "um Wichtigeres: um [sein] Schicksal". Wegen des
Artikels habe die Konferenz beschlossen, ihn "an der Matur durchfallen zu
lassen", das werde bei diesen Noten ohnehin nicht schwer sein. Er solle
doch mit Professor Frank sprechen und sich entschuldigen, vielleicht lasse
dieser sich erweichen.
Das tut Glosère, indem er sich Professor Frank im Hof in der
oben zitierten Weise mit dem Namen "Glauser" als derjenige vorstellt,
der jenen Artikel unter dem Pseudonym "Pointe-sèche" veröffentlicht
hat. Professor Frank explodiert förmlich, und aus seinem Mund schoß ein
"Schwall" von Vorwürfen: Was er, Frank, ihm den getan habe, um auf
diese Weise angegriffen zu werden; das sei keine Kritik, sondern eine
"offenkundige Gemeinheit"; Kritik habe "objektiv" zu sein,
"nicht persönlich": "Sie werfen mir vor", so habe Frank
weiter geschrien, "daß ich dick bin. Was kann ich dafür? Mein Vater ist
dick, meine Mutter ist dick ... Ich selbst mein Herr, habe drei
Entfettungskuren hinter mir ... Ich faste, mein Herr, ich kasteie mich –
kann ich etwas dafür, daß mein Fettansatz zunimmt? [...] bin ich für meine
Hormone verantwortlich?" (Glauser 1937b: 82f.).
Glosère schlägt vor, "einen Widerruf zu veröffentlichen",
doch Professor Frank lehnt ab, denn er ahnt, wie das rauskommen würde; Glauser würde
sich nur weiter über ihn lustig machen, indem auch noch das Gespräch ausschlachte.
Daß der andere Glauser so ergänze ich wiederum in Klammern – so ziemlich
genau das getan hat, kommt in der Novelle nicht vor (Glauser 1915/16: 267–271;
Kommentar: 413). Professor Frank bekräftigt
abschließend, daß er dafür sorgen werden, daß Glauser an der Matura durchfallen
werde: "Vernichten werde ich Sie!" (Glauser 1937b: 83).
Es sei wirklich gemein von ihm gewesen, räsoniert der Erzähler, und er habe die
"Suppe auslöffeln" müssen. Glosère, der vielleicht gerade
damit zu Glauser geworden ist, verläßt das Collège Richtung Zürich,
wo er die kantonale Matur noch vor den Mitschülern des Collège besteht. Aber der
Direktor mußte ihm bestätigen, daß Glauser die Schule freiwillig verlassen
hatte; der eingeschaltete Staatsrat beschloß, die Rezension der Épopée
"als eine rein literarische Angelegenheit und nicht als Angriff eines Schülers gegen
einen Lehrer zu werten". Er habe sich in Zürich immatrikuliert und Chemiker werden
wollen. "Aber statt Chemie zu studieren, wurde ich Dadaist. Man entgeht seinem Schicksal
nicht", schreibt Glauser und schließt mit einer Erkenntnis, die er auch
ohne Chemiestudium, aber vielleicht um so mehr mit dem Schreiben erworben hat. "Nein,
Herr Professor Frank war nicht für seine Hormone verantwortlich. Und darum ist es ganz
in der Ordnung, daß 'Pointe-sèche' hat hungern müssen..." (Glauser
1937b: 84).
II Theorie der Schreibszene
Wer den Text zuvor nicht kannte, hat unter diesem Titel und
in diesem Zusammenhang vielleicht etwas anderes erwartet, vielleicht mehr über
das Eingemachte des Schreibens: die zögerlichen Anfänge, den Papiermangel, das
Scheitern der Veröffentlichung oder den Geniestreich, die unerwarteten
Publikumserfolge, die erste Schreibmaschine, etc.. Doch Glauser ist ein
storyorientierter Schreiber, und als solcher ist er bis heute vorwiegend
gelesen worden: Als Autor vor Kriminalgeschichten vor dem Hintergrund
einschlägiger biographischer Erfahrung und mit kriminalpoetologischen und
vereinzelten psycho-diskurshistorischen Vertiefungen. Besonders die
Akzentuierung der Diskurshistorie wäre das, was man seit der Domestizierung
Foucaults im deutschen Sprachraum eine kulturwissenschaftliche Beschäftigung
mit Glauser nennen könnte. Literarische Texte werden dabei als mehr oder
weniger originelle Oberflächensymptome historisch mehr oder weniger begrenzter
Wissensgründe in sozialer, politischer, wissenschaftlicher und
medientechnischer Hinsicht behandelt.
Und so ließe sich auch mit dem Text über das Schreiben...
verfahren. Bei meiner Zusammenfassung habe ich indes darauf geachtet, die Züge
herauszustreichen, die in der literaturwissenschaftlichen Schreibforschung als Elemente
einer "Schreibszene" figurieren: die verschnitzelten Schulbänke, das
verbotene Schreiben in der Algebra-Stunde, das Wundern über die Geistes-Wirkung
des gedruckten Textes, die Bedeutung des Pseudonyms als Schreibwerkzeug, aber
auch die Übersetzung Platons, das verstohlene Lesen von Dostojewski und die
Hinwendung zum Dadaismus können in einem erweiterten Sinn dazu gehören.
Solche Schreibszenen bilden den Rahmen und den Kern des Textes, die Schwelle zwischen
einem nicht-fiktionalen Außen und dem fiktiven Innenraum und zugleich die
technisch-materielle, das heißt mediale Grundbedingung. Die textinterne,
poetologischeBefragung solcher erzählter, fiktiver Schreibszenen führt
unweigerlich zur Frage der realen oder, nennen wir es eher, dokumentarischen
Schreibszene des erzählenden Textes, mithin zur Entstehung des Textes und zur
Schreibpraxis des Autors.
Mit einiger Konsequenz sind diese im engeren Sinn philologischen
Fragestellungen in den letzten Jahrzehnten fast ausschließlich in der akademisch
eher randständigen Editionswissenschaft, allenfalls in rhetorisch und poetologisch
interessierten Nischen gerade noch geduldeter Textwissenschaft. Eine Ausnahme von
philologischer Seite bildet allerdings die französische Critique
Génétique, die seit vierzig Jahren textgenetische Forschung
betreibt. Eine Ausnahme von kultwissenschaftlicher Seite bilden die medienhistorischen
Gadgets – Paradefall ist Nietzsches Schreibmaschine –, die lange
den einzigen und noch zu wenig fruchtbar gemachten Berührungspunkt zwischen
Philologie und Kulturwissenschaft abgegeben haben.
Wenn die Edition in Forschung und Praxis, die Textgenetik
und zuletzt Schreibforschung in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren vermehrt
betrieben werden und auch zunehmend Beachtung finden, dann verdankt sich dies
– noch jenseits der verdienstvollen Anstrengungen von Personen und
Projekten – einer Reihe von äußeren Faktoren wie die wachsenden
Möglichkeiten der elektronischen Bildverarbeitung und ‑speicherung, die
Einrichtung von Literaturarchiven und die damit verbundenen Problematik der
Aufbewahrung und Verbreitung.
Eine zentrale Rolle spielt in der neueren literaturwissenschaftlichen
Schreibforschung der Begriff der "Schreibszene", den ich vorhin zur
Charakterisierung der – ja, wie wollte man den sonst sagen –
"Schreibszenen" eben in Glausers Text gebraucht habe. Rüdiger Campe
hat die "Schreib-Szene" als heterogenes und "nicht-stabiles Ensemble
von Sprache, Instrumentalität und Geste" bestimmt (Campe 1991: 760).
Jede Schreibszene verschränkt in jeweils singulärer Weise eine semiotische,
eine technologische und eine körperliche Dimension des Schreibens, wie Martin
Stingelin das im Anschluß an Campe und in Anlehnung an das linguistisch
ausgerichtete Modell von Otto Ludwig, auf das ich später eingehen werde,
ausgeführt hat (Abb. 2; Stingelin 2004). Diese triadische Minimalbestimmung
hat ihre Berechtigung vor allem in der theoretischen Differenzierbarkeit. Die
konkrete Anwendung auf Literatur muß natürlich einige Komplikationen
gewärtigen, die in geringerem Maß auch im nicht-literarischen Schreiben
auftreten. Ich werde diese Komplikationen mit Hinweisen auf die Jakobsonschen
Kommunikationsfunktionen zunächst poetologisch erläutern und dann
an den Schreibszenen des Textes veranschaulichen.

Abb. 2: Literarische Schreibszenen 1
Auch beim literarischen Schreiben steht die semiotische und hier vor
allem die semantische Dimension im Vordergrund. In der Regel wird zunächst
eine Geschichte erzählt, ein Gefühl ausgedrückt, eine Landschaft
oder eben auch das Schreiben beschrieben; es steht, mit Jakobson gesprochen,
die Referenz der Mitteilung im Vordergrund. Sodann oder zugleich kommt deren
rhetorisch-stilistische oder, wieder mit Jakobson, poetische Machart zum Zug.
Diese besteht darin, daß
die Mitteilung das Material und die Regeln des Mediums, die eigene Medialität
– Jakobson spricht von der "Spürbarkeit der Zeichen" (Jakobson
1960: 93) – hervorhebt, sei das, in der Poesie, mittels Reim und
anderer Parallelismen, sei das, in der Prosa, mittels mehr oder weniger topischer
Bildlichkeit des Textes, des Schreibens, des Dichtens etc. Es ist ein Definiens
poetischer Prosatexte, ihr poetisches Prinzip oder Modell und ihre Genese in
mehr oder weniger verstellter, eigentlicher oder bildlicher Weise mitzuschreiben,
ob als reale, ideale oder sonstwie stilisierte Schreibszene. Und es gilt als
ein Definiens moderner Texte, daß sie dies in erhöhtem Maß tun
oder, mit einem Schlüsselbegriff ausgedrückt, in erhöhtem Maß
selbstreferentiell sind.
So ergibt sich, daß das literarische oder poetische
Schreiben, das zunächst vielleicht nur semiotisch und vor allem semantisch
wirkt, die anderen Dimensionen der Schreibszene, die technologische und die
körperliche Dimension, notwendigerweise auf die eine oder andere Art
mitschreibt, semiotisch zur Geltung bringt. Und umgekehrt müssen diese beiden
Dimensionen als notwendige Bedingungen der semiotischen Dimension erscheinen.
Die Dimension der literarischen Schreibszene sind ineinander verschränkt und
gehen ineinander über; sie bringen sich gegenseitig hervor, stehen aber
gleichzeitig in einem Kräftespannungsverhältnis, in dem keine Dimension zu
schwach werden darf, wenn das poetische Unternehmen gelingen soll. Die
poetische Funktion, hieße das umgekehrt, wäre das, was die drei Dimensionen in
einem dynamischen Gleichgewicht hält (Abb. 3).
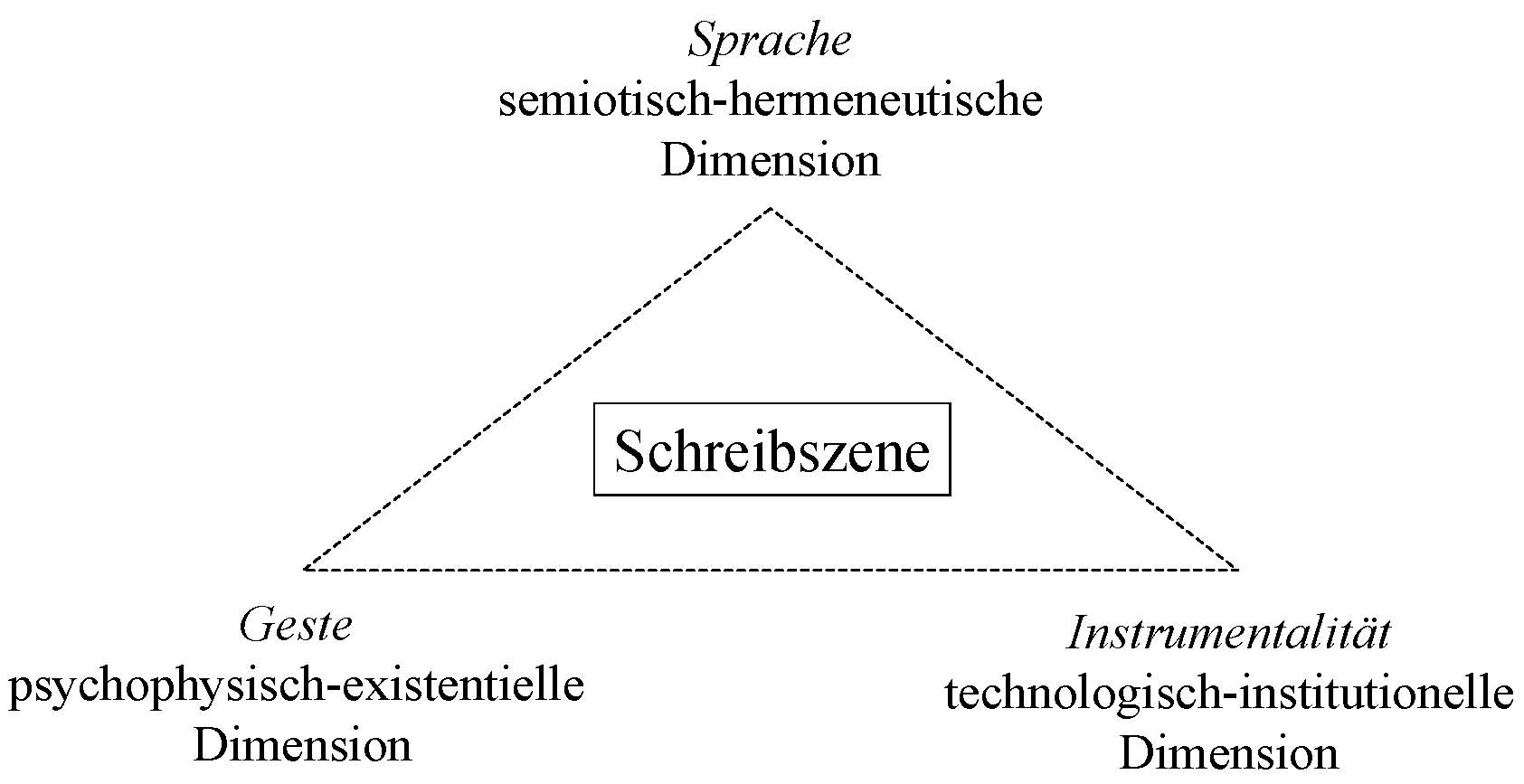
Abb. 3: Literarische Schreibszenen 2
Ich möchte das theoretisch Gesagte nun an den Schreibszenen
des Glauser-Textes veranschaulichen und noch verfeinern; daraus werden sich
zwei weitere Komplikationen ergeben, die auch eine Ausweitung der theoretischen
Schreibszene notwendig machen.
III Anwendung und Erweiterung der Schreibszene: poetische/dokumentarisch, TEXT/Geknitzel
Blicken wir zuerst auf die zentrale Schreibszene, in der Glosère und mit ihm
anscheinend immer noch der Erzähler über die vergeistigende Wirkung des
Druckes staunt und die Umstände der Entstehung der Rezension andeutet.
Wie schön war es, Korrektur zu lesen, welches Wunder
bedeutete es , die Sätze, die ich mühsam in einer Algebra-Stunde geschrieben
hatte, nun plötzlich gedruckt zu sehen. Was, ist es möglich, daß die Sätze
gedruckt so anders aussehen als handgeschrieben? Daß ihnen die Druckerschwärze
Geist verleiht?... (Glauser 1937b: 80).
Das semantische Was und Wie des Schreibens ist hier noch
fast vollständig zurückgehalten und wird erst im Anschluß nach und nach
entfaltet. Statt dessen kommen die technologische und die körperliche Dimension
stark zum Zug: Das Schreiben von Hand während einer Algebrastunde, die reine
Erscheinung des Druckes beim Korrekturlesen würde ich der technologischen
Dimension zurechnen; die Schreib- und Leseaktivität als solche, die offenbare
Zielstrebigkeit des Schreibens und das Staunen über die Wirkung hingegen der
körperlichen. Daraus erhellt, daß zur technologischen Dimension auch die
äußeren Umstände, die Algebrastunde und im weiteren der institutionelle Raum
gehören und zur körperlichen Dimension die psychophysische Disposition und
Aktion des Schreibenden, ja seine ganze Existenzweise. Einen Überschuß der
semiotisch-semantischen Dimension erkenne ich in der Substanz der Druckwirkung,
im "Geist". Als emphatisches Großkonnotat und zugleich Metazeichen
des Textganzen erweitert es die semantische Dimension zur hermeneutischen,
insofern nicht nur beim literarischen Schreiben, sondern bei jeder Zeichenproduktion
überhaupt, die Frage nach dem Sinn des Ganzen im Raum steht. Hier nimmt die
Wendung vom 'Geist des Druckes' die Wirkung mit einer gewissen Ironie vorweg
beziehungsweise stellt den Text insgesamt ironisch in Frage. Aber welchen Text
nun? Die damalige Rezension oder den Text Schreiben...? – Der
semantisierende "Geist" verdeutlicht, daß sich eine Schreibszene,
auch wenn sich wie in diesem Fall nicht auf den Text bezieht, der gerade
geschrieben wird, sogleich auf diesen Text projiziert und die Frage nach dessen
analogischer oder kontrastiver Schreibszene aufwirft.
Die Schreibszene des Pseudonyms "Pointe-sèche"
setzt sich aus verschiedenen Folgen zusammen; die zentrale Folge geht der
vorigen Schreibszene unmittelbar voraus:
Ich muß vorsichtiger sein und mich mit einem Pseudonym
begnügen. Nach vielen Beratungen haben wir ein gefunden:
"Pointe-sèche", auf deutsch: "Grabstichel", das Gerät, das
die Radierer brauchen, um direkt auf die Kupferplatte zu zeichnen...
Letzte Woche
ist im Journal helvétique ein Artikel erschienen, der die Unterschrift trägt:
"Pointe-sèche" (Glauser 1937b: 79f.).
Sie aktualisiert zusammen mit der technologischen und der
körperlichen Dimension auch explizit die semantische, steht doch die Bedeutung
des Wortes zunächst in Frage. Sie betonen beide, erst recht im Kontrast mit dem
"Geist" das Schreiben als solches. Die semantischen Metazeichen, die
das Schreibgerät explizit oder implizit erläutern, sind wohl eher als Schärfe
des Stils und Gültigkeit des Urteils und weniger als Mühe des Schreibens zu
deuten. Die zur psychophysischen oder gar existentiellen Dimension erweiterte
Körperdimension müßte hier auch das Identitätsproblem fassen können. Hier wird
deutlich, daß und wie die Übergänge zur semantischen Dimension, in der die
Bedeutungen und das Verstehen implizit oder explizit problematisiert werden,
nicht nur aufgrund ihrer grundsätzlichen Verschränktheit, sondern auch in bezug
auf ihren Einzugsbereich fließend sind.
Ich nehme noch rasch die verschnitzelten Bänke und die Platon-Übersetzung dazu:
Die Schulbänke sind alt und verschnitzelt in der obersten,
der ersten Klasse. Viele Generationen haben die Schärfe ihrer Taschenmesser am
weichen Holz geprüft.
Und ein Absatz später:
"Meine Weisheit möchte eine geringe und eine
zweifelhafte sein, da sie wie ein Traum ist...", übersetzte Buscarlet,
dessen Nacken mit Pickeln übersät ist. Sein Gesicht ist bleich. Er arbeitet
zuviel, denn er ist Primus und will diesen Titel behalten (Glauser 1937b: 78).
Die erstere der beiden Schreibszenen ist fast nur noch
technologisch-physisch geprägt, und das Schreiben selbst steht als semiotische
Aktivität überhaupt in Frage. In der zweiten Schreibszene, wenn das Lesen und
Übersetzen denn als metonymische Schreibszene gelten soll, ist die
psychophysische Dimension in der Anstrengung des Primus erhalten, die
technologische dagegen läßt sich nur über die topischen Platon-Konnotationen
erschließen: Sokrates bringt als ausgesprochener Schriftskeptiker seine
schriftlose Traumweisheit in Anschlag. Gleichzeitig repräsentiert der
Platon-Text jedoch den Inbegriff eines Textes als abgeschlossenes und
sinnerfülltes Ganzes. Deutlicher und konkreter als vorhin mit dem
"Geist" evoziert die semantische Dimension mit dem Text eine globale
Referenz der Schreibszene.
Nun kann ich die theoretische Schreibszene noch einmal um
zwei Punkte erweitern; der eine ergänzt sie, der andere entgrenzt sie. Zum
ersten Punkt: In den betrachteten Schreibszenen, ganz deutlich in der letzten,
lassen sich zwei Extrempole des Spektrums ausmachen, zwischen denen sich alles
Schreiben bewegt: Den einen bildet der ganze und sinnerfüllte Text, TEXT mit
Majuskeln, Text als ideale, absolute, globale Referenz, den anderen das kaum
noch Schreiben zu nennende Gekritzel, ein Quasi-Schreiben, kontingent,
fragmentarisch, ephemer, dysfunktional in bezug auf das, wozu literarisches
Schreiben sonst zu dienen scheint, nämlich Textproduktion.
Daraus ergibt sich der zweite Punkt: Das polare Spannungsverhältnis zwischen
globalem Text und kontigentem Gekritzel bildet
gleichsam einen äußeren Rahmen, welcher der von Campe abgeleiteten Schreibszene
bislang fehlte. Bis anhin und innerhalb des Textes wurde sie durch die
Wechselwirkung zwischen poetischer Kraft und dem Zusammenspiels der drei
miteinander verschränkten Dimensionen konstituiert. Doch diese innere erzählte
Schreibszene bleibt nur so lange erhalten, als sie von der Schreibszene des
erzählenden Textes ferngehalten wird. "Gerade der Abgrund ihrer Selbstreferenz
öffnet Texte nach außen", so hat Friedrich Kittler den kritischen Punkt
der poetologischen Immanentisierung und damit die Notwendigkeit von dokumentarischen
Analysen markiert (Kittler 1988: 50). Wenn der erzählende Text selbst als
dokumentarische Gewordenheit und Gemachtheit unweigerlich in den Blick rückt
und somit den materiellen und metaphorisch-begrifflichen Rahmen durchbricht, so
löst sich die poetische Schreibszene in ihre einzelnen Dimensionen
beziehungsweise in die fragmentarisch dokumentierten Materialien und Praktiken
auf. Weil dieser poetisch-begriffliche Textrahmen in der Alltagskommunikation
keineswegs die Regel ist, hat Otto Ludwig in seinem linguistisch orientierten
Modell eine vierte Dimension zu den drei etwas anders als in der literarischen
Schreibszene von Campe und Stingelin gelagerten Dimensionen hinzunehmen müssen,
die er die operative Dimension nennt.4
Erst diese operative Dimension, deren Paradefall dann natürlich auch
die Textproduktion ist, integriert die anderen drei, und Ludwig unterscheidet
deshalb grundlegend zwischen integriertem Text-Schreiben und nicht-integriertem
sonstigem Schreiben.
Im Übergang von der poetologisch-philologischen Betrachtung zur
dokumentarisch-philologischen Betrachtung des literarischen Schreibens braucht man
nun so etwas wie eine operative und integrative Dimension, weil die poetische
Funktion nur noch als eine ideale Möglichkeit gelten kann. Aber es zeigt sich
rasch, daß auch und gerade beim literarischen Schreiben die Produktion von Text
im Sinn eines abgeschlossenen und sinnerfüllten Ganzen selbst nur eine, wenn
auch ideale und wirkungsmächtige Möglichkeit ist, welche die heterogenen
Schreibpraktiken und singulären Schreibakte nicht zu integrieren vermag, ja daß
diese der Textproduktion geradezu Widerstand leisten. Die moderne Literatur
thematisiert ja gerade diese desintegrierenden Momente besonders häufig und
stark. Und so muß man auch das Verschnitzeln der Bänke im Spannungsverhältnis
zum Platon-Text verstehen. Was man für die dokumentarisch-philologische
Betrachtung braucht, ist also weniger ein ideales Textmodell, als genau das aus
dem Glauser-Text gezogene heuristische Spannungsverhältnis zwischen
globalem Text und kontingentem Gekritzel (Abb. 4).
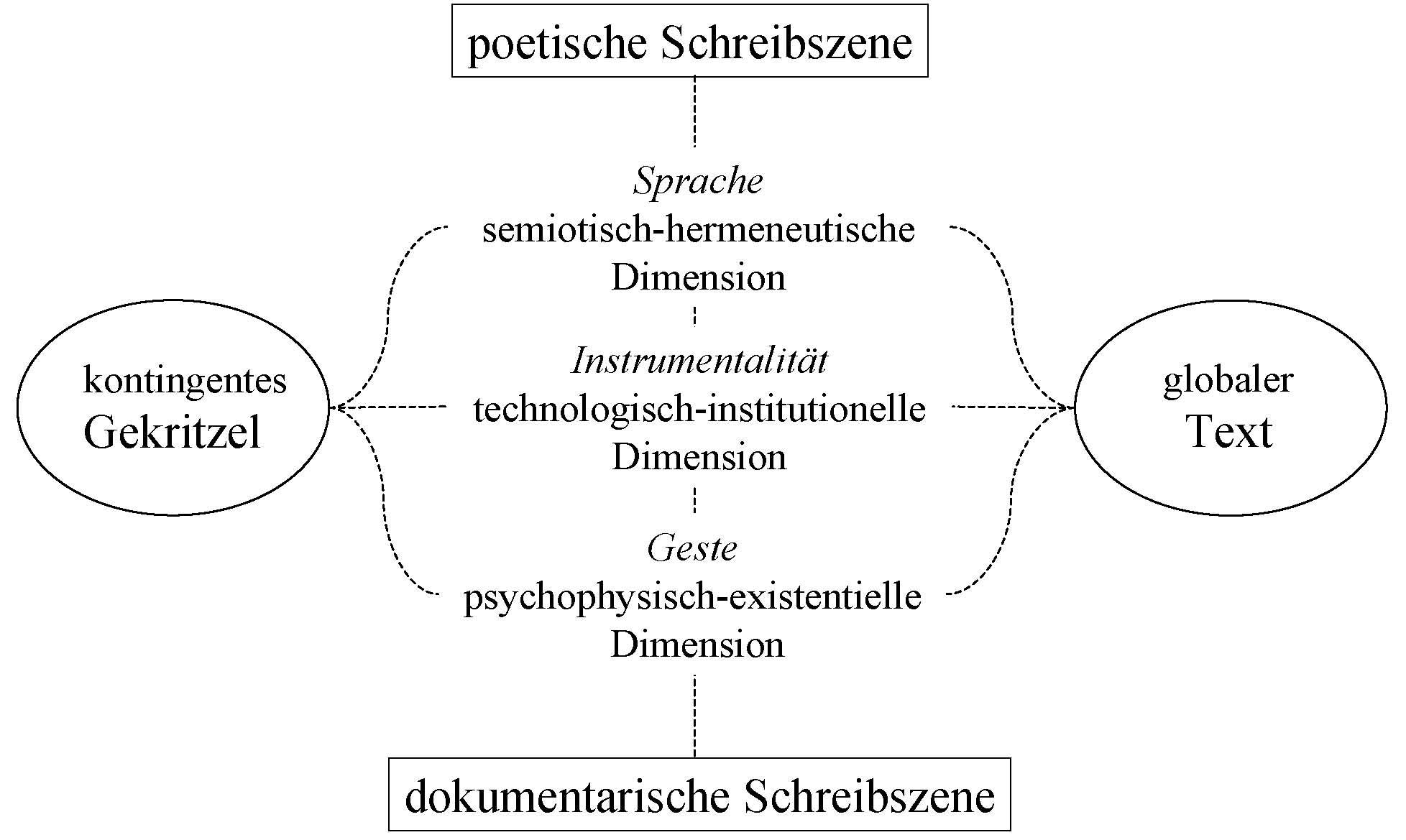
Abb. 4: Literarische Schreibszenen 3
In den letzten Jahren haben neben der Schreibforschung auch
die Textgenetik und die Editionsforschung sowie die Faksimile-Editionen
(Nietzsche, Kafka, Walser) und entsprechende Publikationen der Literaturarchive
dazu beigetragen, das Schreiben auch möglichst jenseits oder diesseits des
Telos des globalen Textes zu betrachten. Das im Schweizerischen Literaturarchiv
angesiedelte Projekt "Textgenese und Schreibprozeß" hat mit Schwergewicht
auf Glauser und Christoph Geiser und einem erweiterten Kreis von Untersuchungen
unter dem Titel "Anfangen zu schreiben" versucht, noch verstärkt auf
das konkrete, singuläre und situative Schreiben in seiner institutionellen,
technischen, materiellen und existentiellen Bedingtheit und Umständlichkeit zu
fokussieren. Daraus möchte ich Ihnen
zum Schluß nun noch ein paar Ausschnitte vorlegen, die Einblick geben in die dokumentarischen
Schreibszenen Glausers im Spannungsfeld von Text und Schreiben.
IV Kurze Revue der Schreibszenen in Wert und Nachlaß
Friedrich Glausers literarische Anfänge, von denen auch der Text Schreiben...
erzählt, scheinen typisch zu sein für das literarische Anfängertum.
Der Anfänger möchte nämlich gerade sich selbst überspringen und
seine Produkte als fertige und ganze Texte, Bücher oder Werke der reifen Meisterschaft
erscheinen lassen. Die probaten Mittel dazu sind etwa motivische Remakes, stilistische Imitationen,
überhebliches Urteilen oder avantgardistisch-revolutionäre Posen. Aber gerade
ihr zur Kenntlichkeit entstellter Gebrauch verrät den Anfänger, den sie als
Könner maskieren sollten.
Glosère selbst erscheint im Text Schreiben... als ein Schreiber,
der den Text zügig runterschreibt. Als ein solcher tritt auch der Protagonist einer
frühen, zwischen 1917 und 1919 entstandenen Novelle mit dem Titel Der Käfer
(der Gedanke an die 1915 erschienene Verwandlung Kafkas ist durchaus berechtigt). Nachdem
dieser Dichtergenie namens Georg von Ehrenstein zwei Gedichtbände nur so zu Papier geworfen
hat, gerät er als Dramatiker dann ins Stocken, unzählige Entwürfe landen im
Papierkorb und der Käfer krabbelt als Halluzination des horror vacui und horror
scripturae auf dem weißen Papier. Schließlich läßt er das
Schreiben ganz bleiben, und dann gibt auch der Käfer Ruhe (Glauser 1917/1919).
Auch Glauser selbst war bekannt für seine rimbaudhaften Attitüden, die der
Käfer-Protagonist vorführt; er galt in seinen Kreisen als der kommende
Mann. Er scheint sich schnell daran gewöhnt zu haben, druckfertige Manuskripte und,
wenn immer möglich, Typoskripte anzufertigen, und er kann sicher als einer der
frühesten schreibmaschinenversierten Schriftsteller gelten. Der dokumentarische
Befund im lückenhaften Nachlaß kann dies bestätigen: Vom frühen
Glauser, daß heißt bis zum Eintritt in die Fremdenlegion im April 1921,
gibt es keine Notizzettel, Notizhefte oder Einzelblätter mit Stichworten, Konzepten,
Personenlisten, wiederholten und abgebrochene Anfängen etc., die das Schreiben
unmittelbar als heterogene Praktiken des Zögerns oder als homogene Praxis des Planens
dokumentieren würden. Glausers Schreiben tendiert zum druckfertigen Manuskript
(Abb. 5) beziehungsweise zum wenig bis mittel von Hand überarbeiteten
Typoskript (Abb. 6) Die Reste und Spuren des zögerlichen Beginnes, des
Verwerfens und Abbrechens scheinen entweder gar nicht erst entstanden oder dann
getilgt worden beziehungsweise verloren gegangen zu sein. Unfertige und stark
überarbeitete Texte wie im Fall des Manuskripts des Christus-Dramas Die
Bekehrung (1919/20) oder von Mattos Puppentheater (1919/20) scheinen eher
Ausnahmen zu sein (Abb. 7).
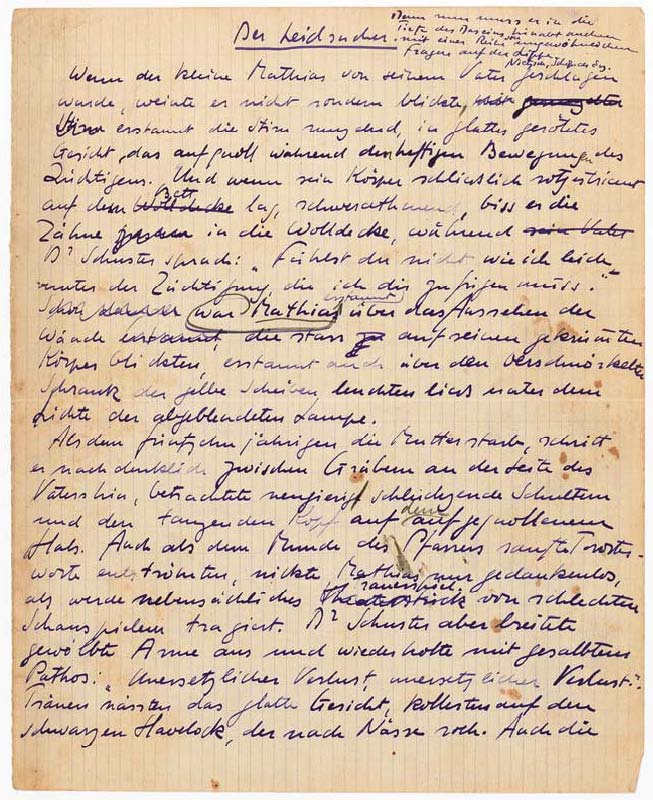 |
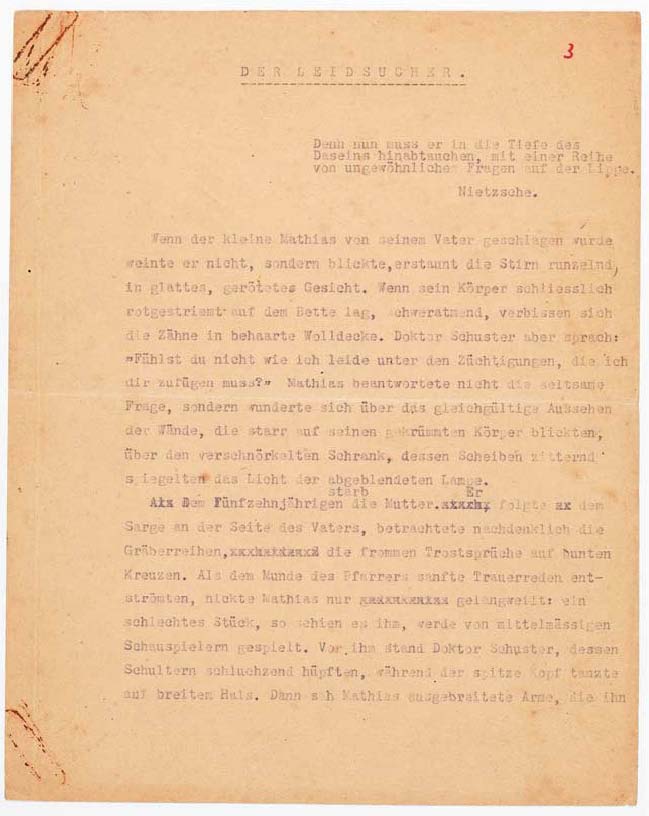 |
| Abb. 5: Friedrich Glauser (zwischen 1916 und 1920): Der Leidsucher.
Manuskript. SLA-Signatur D–42 (Sammlung Binswanger).5 |
Abb. 6: Friedrich Glauser (1919/1920): Der Leidsucher.
Typoskriptdurchschlag. SLA-Signatur A–1. |
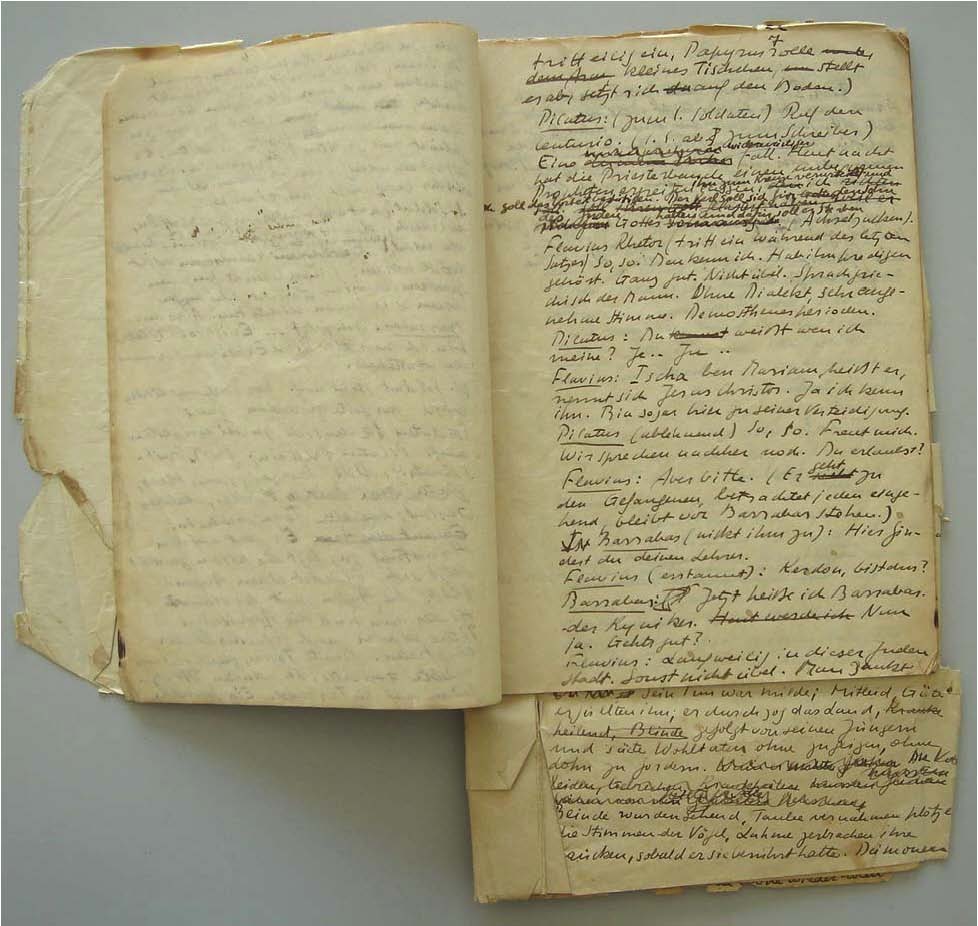
Abb. 7: Friedrich Glauser (1919–1920): Die Bekehrung. Manuskript. SLA-Signatur
A–3–e–8.
Die Briefe, die keineswegs frei von Stilisierungen sind,
ergeben ein uneindeutigeres Bild. 1918 etwa bekennt er sich schon zur Arbeitsweise
Flauberts, was die strenge Selbstkritik und die konkrete Überarbeitungsmethode
angeht: Er habe eine Novelle begonnen, aber "fünfzehn Seiten sind sofort
in den Papierkorb gewandert, und zwei sind geblieben. Wenn ich den Größenwahn
hätte, würde ich sagen, daß ich in den Fußstapfen Flauberts
wandle."6 Wenn
Glauser später in seinen Briefen davon berichtet, Texte in einer Nacht
runtergeschrieben zu haben, so mag das fallweise zugetroffen haben; aber ebenso
sind Klagen über den endlosen Aufschub vor dem Schreibenanfangen und die
überwindbaren Stockungen überliefert.
In dieser ersten Phase dominieren in der dokumentarischen Schreibszene die semantische
und die psychophysisch-existentielle Dimension des Schreibens, das heißt die
technologische Dimension (die man durch manche Schreibszene wie zum Beispiel die
Zürcher Schreibmaschinenszenen noch hervorheben könnte) steht ganz in
deren Diensten. Aber es wäre wohl schon hier falsch, den frühen Glauser
gemäß der von Louis Hay eingeführten und seither mehrfach
weiterentwickelten Unterscheidung zwischen einem programmierten,
textorientierten einerseits und einem prozessualen,
schreibdynamischen Typus andererseits dem ersteren zuzuschlagen
(Hay 1984: 313f.).
Der mittlere Glauser, das heißt von 1925 (nach Rückkehr aus
der Fremdenlegion, Paris und Charleroi) bis 1936, der dann auch die längeren
Texte verfaßt, muß in den Schreibprozeß eintauchen wie
Wachtmeister Studer in das Milieu seiner Fälle. Studer macht in Schlumpf
Erwin Mord nur dysfunktionalen Gebrauch des Notizbuches, malt Männlein
oder benutzt es als Deckung; er muß den Fall ebenso ohne Notizen lösen
wie Glauser die Geschichte ohne Brouillon und wohl auch ohne sonstige Vorarbeiten
schreiben muß (daß er für die Studer-Romane verschiedene Literatur
benutzte, wäre dann eine andere Frage). Wenn Glauser in einem Brief davon spricht,
daß er den Schluß von Matto regiert "ohnehin nicht
'broullonieren'" könne, so scheint die Rede von Brouillons mehr eine Art
Deckung und Trost für die Ungewißheit des Fortgangs des Schreibens zu
sein.7 Tatsächlich
sind aus dieser Zeit auch keine Notizen überliefert.
Die Kehrseite dieses Eintauchens ist, daß ihm die Story entgleitet wie Studer
seine Fälle.Im wechselnden Ton der Verzweiflung und des Stolzes klagt er darüber,
daß ihm die Sache "zu poetisch" gerate,8
er sehe "vor lauter Details die ganze Handlung nicht mehr". Er
habe sich noch nie "so abgeplagt wie mit diesem Roman", gemeint ist Matto regiert,
"nicht einmal mit meinem Legionsroman. Und doch ist er noch immer voller
flottements".9 Auch das
Anfangen und Wiederanfangen wird problematisch: Wenn er nicht in den Schreibfluß eintauchen
kann oder immer wieder herausgerissen wird, so muß er von vorne anfangen oder radikal
bis zur Unleserlichkeit überarbeiten. Der Text im Sinn eines Ganzen wird sozusagen vom
Schreiben überflutet und weggeschwemmt, auch wenn schließlich doch erreicht. Das
ist im Nachlaß recht deutlich dokumentiert, am anschaulichsten im Typoskript des
Legionsromans Gourrama, an dem er neun Jahre immer wieder gearbeitet hat (Abb. 8).
Abb. 8: Friedrich Glauser (1929–1937): Gourrama. Typoskript und
Typoskriptdurchschlag: 171 & 244. SLA-Signatur A–2–a.
Der Vergleich zwischen dem fahndenden Studer und dem schreibenden Glauser ist keineswegs
gesucht und erweist sich noch in anderer Hinsicht als triftig.10 Er läßt die
technologische Dimension noch erheblich stärker und mit ihr die existentielle in
ganz fundamentaler Weise hervortreten. Schlumpf Erwin Mord und Matto regiert
sind regelrechte Aktenromane. Es wird verhört und protokolliert, untersucht und
begutachtet, Akten werden zitiert, kopiert, manipuliert, vernichtet. Studers skeptischer
Umgang mit den aktenförmigen Redeformen, Papieren und Schriftverfahren zeigt,
daß er sich der existenzentscheidenden Bedeutung der Akten bewußt ist.
im Schatten von Studers Ermittlungen führt die Narration die aktenförmig
hervorgebrachten Existenzen an jenen Punkt zurück, wo sie durch diese Diskurspraktiken
dem namenlosen Leben entrissen worden sind.
Glauser selbst kann sich, das ist bekannt, eines stattlichen
Aktenstapels rühmen, in dem sich seine Existenz verschrieben findet
(Abb. 9). Es ist mittlerweile auch bekannt, daß Glauser, als er in der
Irrenanstalt wegen seiner Schreibmaschinenfertigkeit zum Abschreiben von Akten
herangezogen wurde, einen Durchschlag für sich abgezogen hat, um daraus teils
wörtlich den Demonstrationsfall des Kindermörders Pieterlen in Matto
regiert zu gestalten (Abb. 10, vgl. Glauser 1936/1937). Glauser erweist
sich nicht nur in seinen Kriminalromanen gleichsam
als Diskursanalytiker in eigener Sache, indem er die schrift- und aktenförmigen
Diskurspraktiken der Polizei, Justiz und Psychiatrie bis ins Dokumentarische
hinein literarisch vorführt. Hier muß der Philologe, will er sich Glausers
Sache gewachsen zeigen, auch zum Diskurshistoriker werden.
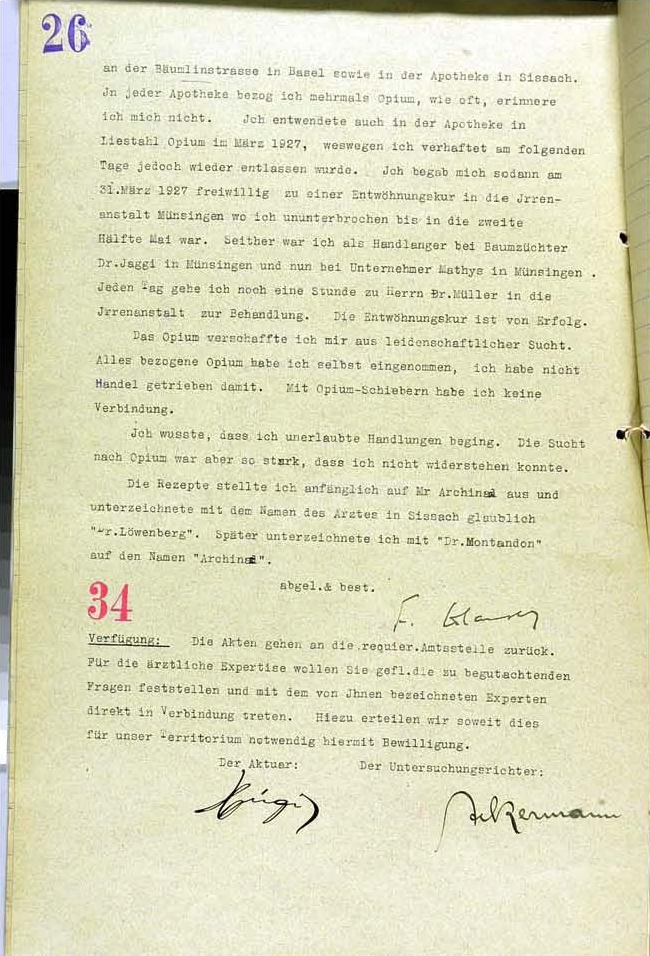
|
Abb. 9: Protokoll eines Verhörs mit Friedrich Glauser, angeklagt wegen
Opiumdiebstahls, Liestal 1928, Staatsarchiv des Kantons Baselland, Liestal, StABL GA 4003
Überweisungsbehörde UeB 02.02.03.01.17 Nr. 828 (1928).
|
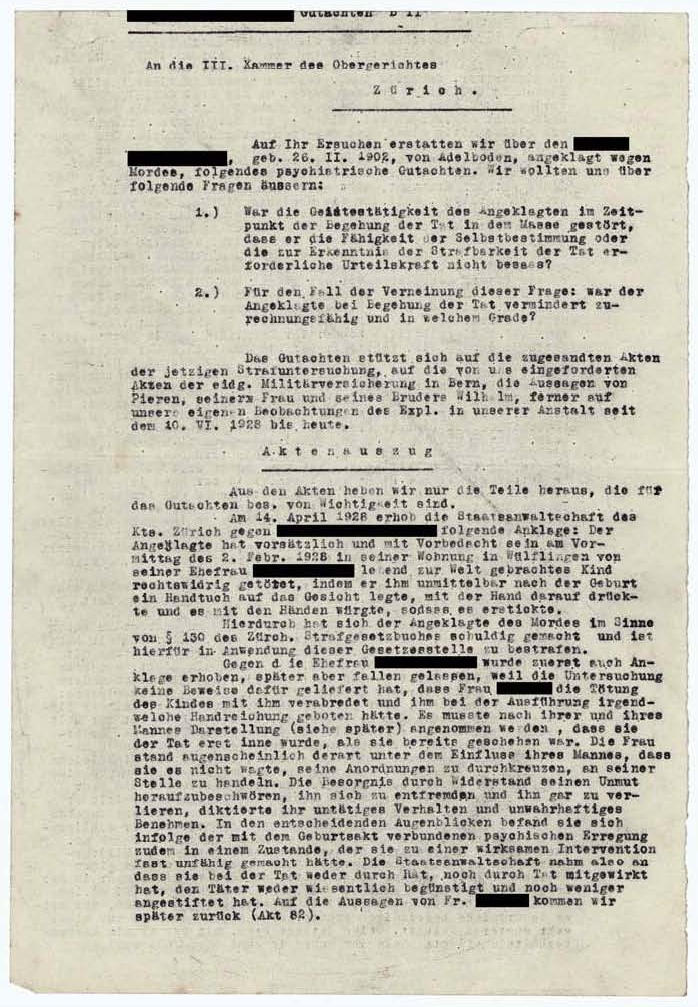
|
Abb. 10: Typoskriptdurchschlag, den Glauser beim Abtippen von Akten anfertigte und
zurückbehielt, vermutlich 1931, SLA.
|
Nach den drei Studer-Romanen hat Glauser genug von der Unwägbarkeit des Schreibprozesses:
"[...] es ist zum ersten Mal, daß ich versuche, zuerst einen Plan zusammenzuleimen,
bevor ich mit der anderen Arbeit beginne. Und es fällt immer schwer, die Arbeitsmethode zu
ändern",11
bekennt er in einem Brief, nachdem er schon seit einem Jahr tatsächlich begonnen hat,
Notizhefte zu beschreiben. Darin finden sich elementare Szenenskizzen, Personenlisten mit
Namenszuordnungen, zwischendurch lyrische Einsprengsel, Kolonnenaufstellungen mit Glausers
Lebensstationen, sogar eine zeichnerische Skizze. Die literarischen Notizen beziehen sich
hauptsächlich auf das Projekt des Ascona-Romans, an dem er bis zuletzt arbeitet und in
dem er den neuen Ehrgeiz des programmierten, textorientierten Schreibens realisieren möchte
(Abb. 11)12. Im letzten,
in Nervi begonnenen Notizheftes mit dem Aufdruck des "Esercito italiano / marina" mit
ca. 20 Seiten Notizen und Entwürfen, stellt er sogar eine Warntafel auf: "Aufpassen!!!! /
Beim Schreiben / nicht immer / ausrutschen!!!!"13 (Abb. 12 & 13), die ihn, so
darf man das wohl verstehen, davor bewahren soll, sich in den Schreibfluß hinein zu begeben.
Abb. 11: Friedrich Glauser, Blaues Notizheft, 1936/37, S. 1 und U. 1,
SLA-Signatur C–11.
Abb. 12: Friedrich Glauser, Notizheft "Esercito italiano", 1938, U. 1
und S. 27, SLA-Signatur C–11.
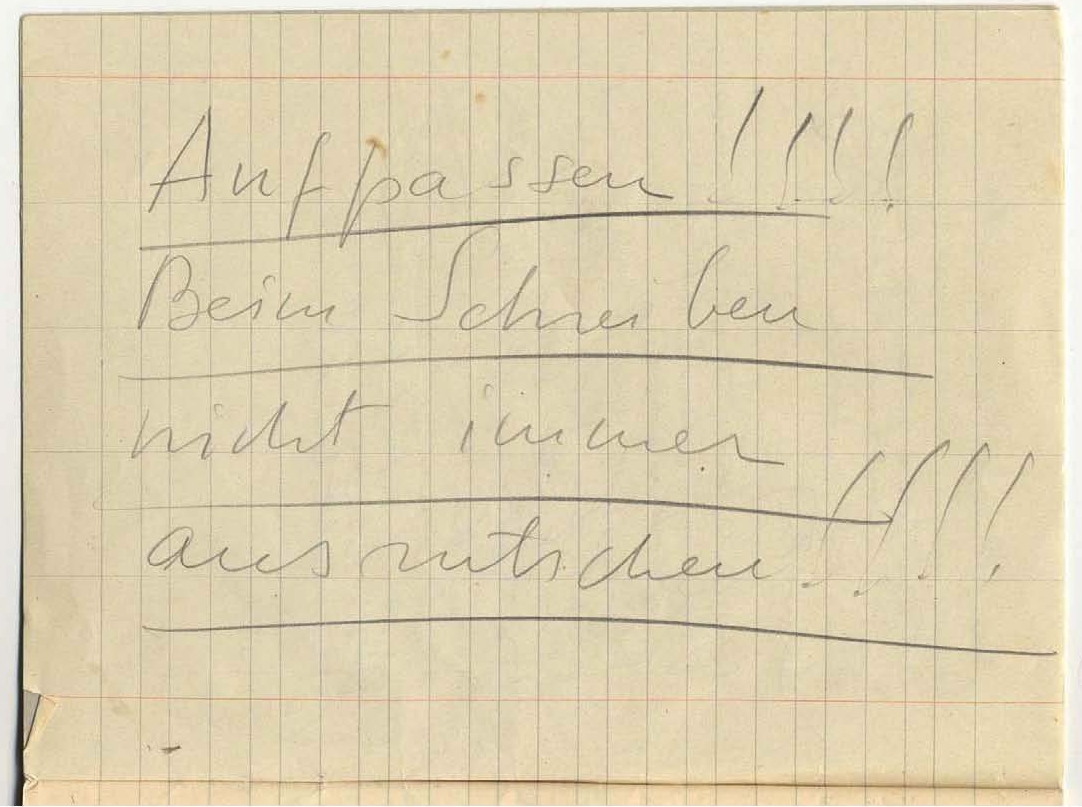
Abb. 13: Friedrich Glauser, Notizheft "Esercito italiano", 1938, S. 2,
SLA-Signatur, C–11.
Tatsächlich sind zum Ascona-Roman, dem auch das letzte
Notizheft mehrheitlich gewidmet ist, mehrere Anfangsfragmente erhalten, die vermuten
lassen, daß Glausers Schreiben im Hinblick auf das Ziel eines fertigen Textes
der Methodenwechsel nicht so gut bekommt (Abb. 14). Indem er nun
programmiert zu schreiben und so einen Überblick über und Ausblick auf das
Textganze zu erhalten versucht, statt sich in den Schreibfluß zu stürzen und
treiben zu lassen, scheint er aber gar keinen ganzen Text mehr fertig zu
bringen. Hier wird die semantische Dimension von der technologischen und
existentiellen geradezu erdrückt.
|
Abb. 14: Friedrich Glauser, Ascona-Roman, Typoskript, Frühjahr 1938 oder
später, 2 Bl. Folio (41,5 × ca. 22,5, linker Rand beschnitten),
4 S., S. 1f., SLA-Signatur A–3–a–3.
|
Die Zwickmühle und die Möglichkeit oder Unmöglichkeit, ihr zu entkommen,
können in der Tat nicht losgelöst von dem extremen Existenzdruck betrachtet werden.
Im Herbst 1938 schreibt Glauser regelrechte Bettelbriefe, die mitunter Droh‑ oder
Erpressungscharakter annehmen. Am 1. Dezember 1938 bittet er Friedrich Witz von Zürcher
Illustrierten um Vorschuß, schickt ihm anscheinend zwei "Romananfänge"
und bietet als Garantie ein 'fertiges Brouillon' feil:
Der Plan und das Brouillon des Asconeser Romans ist auch schon fertig und ich wage
nicht, das Zeug an Sie zu schicken, denn eine Angstpsychose – wie man so schön in
gewissen Kreisen sagt – hat mich überfallen, das könne wieder verlorengehen
und dann säße ich wieder da mit nichts. Begreifen Sie, daß das Brouillon
eines Romans mir – uns – wichtiger scheint als das Geld, welches wir damit
ergattern könnten. / Überhaupt, wie steht es mit Ihrem Vertrauen zu
mir?14
Mit dem 'fertigen Plan und Brouillon' kann wohl nicht viel anderes gemeint sein als das substantiell
doch recht dürftige Schreibheft des "Esercito italiano". Doch es ist keineswegs eine
Ausnahme, daß Gauser blufft; die brieflichen Vertröstungen und Rechenschaften gegenüber
den Text‑ oder Geldgläubigern scheinen oft nicht mit dem Stand der Dinge überein zu
stimmen. Ja, es macht den Eindruck, als bedürfe Glauser auch ohne Notlage, wenn nicht des kruden
Selbstbetrugs, so doch des Drucks, den Lügenkredit dann in kürzester Zeit noch buchstäblich
abzuschreiben. Aber explizit und auf diese Weise Vertrauens‑ und Geldkredit für etwas zu
fordern, was so nicht vorliegt, läßt doch auf eine akute Notlage schließen. Das
unterstreicht − allerdings jenseits jeden kausalen Zusammenhangs − der Umstand, daß
Glauser eine Woche später gestorben ist.
V Ethische Dimension
So sehr die Vertrauensfrage auch auf die äußere Ökonomie des
Schreibens bezogen ist, so verweist sie dennoch oder erst recht auf die inneren
Vertrauens‑ und Verantwortungsverhältnisse des Schreibens. Und um diese
scheint es doch in Glausers Schreiben-Text irgendwie zu gehen. Dieses 'Irgendwie'
möchte ich nun in einem letzten Punkt als ethische Dimension der
Schreibszene wenigstens noch skizzieren. Die ethische Dimension stellt die
Frage nach dem Schreiben als im weitesten Sinn politische Haltung, die
individuelles und kollektives Verhalten, das heißt Denken, Sprechen, Empfinden
und Handeln in eine mehr oder weniger kohärente Beziehung zueinander setzt. Als
solche überschreitet sie die einzelne Schreibszene und verbindet die poetische
und die dokumentarische Schreibszene, indem sie die Frage nach der
diskurspraktischen Wirkung in einer (historisch) gegebenen Realität stellt.
Ich greife noch einmal das bereits zitierte Ende des Schreiben-Textes auf:
"Nein, Herr Professor Frank war nicht für seine Hormone verantwortlich. Und
darum ist es ganz in der Ordnung, daß 'Pointe-sèche' hat hungern
müssen..." (Glauser 1937b: 84). Das Unrecht, das mit Hunger
zu sühnen war, scheint darin bestanden haben, daß Pointe-sèche
alias Glosère alias Glauser den Autor des Epos Sang eines Einzelgängers
und dessen Helden miteinander identifiziert, die Wirklichkeit und den literarischen Inhalt
aufeinander projiziert hat, um beides sich gegenseitig disqualifizieren zu lassen. Man ist
versucht, aus dem abschließenden Urteil, das der Autor-Erzähler-Glauser
über das Vergehen von Pointe-sèche-Glosère und die ausgleichende
Gerechtigkeit des Lebens spricht, eine gewisse Ironie herauszuhören. Wie ist sie zu
verstehen: Bedeutet es, daß die Identifizierung und der grobe Ton eigentlich schon
das richtige Mittel der Kritik gewesen seien. Immerhin betont der Autor-Erzähler-Glauser
zuvor zweimal, daß der "kleine dicke Mann [...] recht" gehabt habe, selbst
wenn dann "auch die Art der Verteidigung lächerlich" gewirkt habe? (Glauser
1937b: 83f.). Jedenfalls kann man die Verführung, die Eigenschaften
und das Verhalten Professor Franks weiter wirken zu lassen, auch hier noch spüren.
Trotzdem würde ich die dreifache Wiederholung des Umstandes, daß Professor
Frank im Recht gewesen und nicht für seine Hormone verantwortlich sei, allenfalls
dahingehend ironisch verstehen, daß deswegen das Buch immer noch schlecht sei. Ein
Ironiesignal könnte man schließlich in der Wendung "schon in Ordnung"
wahrnehmen, die sich auf das Verhältnis beziehungsweise das Unverhältnis von Vergehen
und Strafe bezieht. Denn daß es Glauser in der Folge gerade wegen der ihrerseits doch
recht lächerlichen Rezension immer wieder so dreckig ergehen sollte, würde man
nicht ernsthaft behaupten wollen.
Und doch scheint Glauser damit eine grundlegende Frage zu umkreisen, die ihn beschäftigt
und auf die er keine bündige Antwort geben kann, nämlich die Frage nach dem
Vertrauen in und der Verantwortung für das Schreiben, sowohl von Seiten des Schreibenden
als auch des Lesenden. Immerhin erscheint der Text Schreiben...in einem dafür
bedeutsamen Kontext, dessen sich Glauser beim Schreiben durchaus bewußt ist. Er
schreibt ihn auf explizite Anfrage als Selbstpräsentation und zur Vorankündigung
des Abdrucks seines dritten Studer-Romans, Die Fieberkurve. Erwartet wurde von Friedrich
Witz wohl etwas anderes, wohl deutlich Existentielleres über die Anfänge eines
Autors, den es nun − wir befinden uns im Jahr 1937 − als nationalen
Autor aufzubauen galt (Abb. 15). Das wird sofort klar, wenn man den redaktionellen
Lead zum Schreiben-Text liest:
Studer bleibt der alte − ein Mann mit weisem
Verständnis für die Unzulänglichkeiten der Welt und der Menschen; die
Erlebnisse aber, die auf ihn eindringen, sind eigenartig neu und aufregend. Wir
beginnen in unserer nächsten Nummer mit diesem bemerkenswerten Roman unseres
Schweizer Autors. Heute aber möchten wir Friedrich Glauser auf andere Weise zu
Worte kommen lassen und ihn von seinen ungezählten Abenteuern eines aus seiner
Schulzeit erzählen lassen. Er betitelt seine Erinnerung: Schreiben...
(Redaktioneller Lead zu Glauser 1937a).

Abb. 15: Titelseite der Zürcher Illustrierten 49,
Dezember 1937, in welcher der Abdruck der Fieberkurve beginnt.
Die Konstruktion der Entsprechungen zwischen Autor und Figur ist keineswegs grob,
aber doch bestimmt. Diesem Lead folgt indes ein Text, der von einem groben Mißbrauch
solcher Entsprechungen als Urszene einer Schreibkarriere erzählt – eine
gewiß subtile Antwort, die insofern bestimmt ist, als sie diese Entsprechungen
in Frage stellt. Aber was kann man daraus für Einsichten für das die
Verpflichtungs‑, Verantwortungs‑ und Vertrauensverhältnisse des
Schreibens gewinnen? – Christa Baumberger hat in ihrer jüngst erschienenen
Monographie zur Polyphonie bei Glauser das Spiel der Identitäten in den Texten
Glausers und die vielfältigen poetisch-dekonstruktiven Taktiken untersucht, mit
denen sich Glausers Schreiben der Festschreibung entzieht (Baumberger 2006). So
sehr er wegen des Ruhmes davon verlockt zu sein scheint und existentiell tatsächlich
darauf angewiesen ist, unterläuft Glauser solche Bestrebungen der
Majorisierung und Hegemonialisierung von vornherein, ohne sie explizit
konterkarieren zu müssen. Auch und gerade dort, wo es sich auf ein Volk
zuschreibt, betreibt dieses Schreiben, wie auch Baumberger ausführt, eine
konsequente Minorisierung oder, mit Gilles Deleuze ausgedrückt, ein
"Minoritär-Werden", ein Minder-Werden. Schreiben als ein
"schöpferisches Werden", schreibt Deleuze (1994: 205), und
"Werden heißt nicht eine Form erlangen (Identifikation, Imitation,
Mimesis), sondern die Zone einer Nachbarschaft, Ununterscheidbarkeit oder
Nicht-Differenzierung finden, so dass man sich nicht mehr von einer Frau,
einem Tier oder einem Molekül unterscheiden kann" (1993/2000: 11).
Das Schreiben kann auf nichts setzen, Vertrauen kann es zuerst und zuletzt nur in
sein Werden und Ergehen haben, das heißt in nichts. Gegen alle Versuche, sich
den ökonomischen, politischen, moralischen, narratologischen oder stilistischen
Erfordernissen anzupassen, schreibt Glauser nur wirklich, wenn er, wie er schreibt,
"vor lauter Details die ganze Handlung nicht mehr" sieht oder, etwas
verallgemeinert, vor lauter Schreiben den Text vergißt – und
schließlich doch einen solchen geschrieben haben wird.
Anmerkungen
* Der Text basiert auf dem an der Jahresversammlung der
Schweizerischen Akademischen Gesellschaft für Germanistik (SAGG) vom 24.
November 2007 im Schweizerischen Literaturarchiv (SLA, in der National-bibliothek,
Bern) gehaltenen Vortrag; der mündlich Duktus wurde bei der Überarbeitung
weitgehend beibehalten. zurück
1 Zum Begriff der Karriere in der Literaturgeschichte vgl.
Schneider (1981). zurück
2 Friedrich Glauser, Brief an Gotthard Schuh, La Bernerie,
10. Mai 1937. (Briefe 2: 602). zurück
3 Vgl. Brief an Charly Clerc, La Bernerie, 31. Oktober 1937.
(Briefe 2: 780). zurück
4 Vgl. Ludwig (1995): 1. Semiotische Dimension:
Produktion von Zeichen; 2. technologische Dimension: Schreiben als
Handwerk; 3. linguistische Dimension: Schreiben als Handlung (in Analogie
zum Gesprochenen aufgrund eines Wissens); 4. operative Dimension:
Integration in einen Handlungszusammenhang. zurück
5 Alle folgenden
Abbildungen mit SLA-Signatur stammen aus dem Nachlaß Friedrich Glauser,
Schweizerisches Literaturarchiv (SLA), Bern. zurück
6 Brief an Robert Binswanger, Münsingen, 4. August 1918.
(Briefe 1: 35, Anm. 4). zurück
7 Brief an Martha Ringier, Bolligen, 11. März 1936.
(Briefe 2: 192. Im Original ohne "i" nach dem "u").
zurück
8 Brief an Josef Halperlin, Waldau, 27. April 1932.
(Briefe 2: 268). Vgl. Brief an Martha Ringier, Waldau, 17. März 1936.
(Briefe 2: 194). zurück
9 Brief an Martha Ringier, Waldau, 9. April 1936.
(Briefe 2: 243f.). zurück
10 Diese Parallele zieht ein Fragment zum Ascona-Roman
explizit. Auf Studers Frage, was er denn schreibe, antwortet der Ich-Erzähler
mit "Novellen"; doch jetzt sei er an einem Roman, aber "ich weiß
nicht, ob er etwas geben wird", gesteht er. "€be", kommentiert
Studer, "[s]o etwas könne man wohl nie vorher sagen... Ob es etwas geben
werde nämlich... Es sei wie bei einem Kriminalfall..." (Glauser 1938: 261).
zurück
11 Brief an Robert Schneider, Nervi, 28. August 1938.
(Briefe 2: 865). zurück
12 Vgl. Friedrich Glauser, Blaues Notizheft, 1936/37:
S. 1 & U. 1. SLA-Signatur C–11.
zurück
13 Friedrich Glauser, Notizheft "Esercito italiano /
marina", 1938: S. 2. SLA-Signatur C–11.
zurück
14 Brief an Friedrich Witz, Nervi, 1. Dezember 1938.
(Briefe 2: 925). zurück
Literatur
Baumberger, Christa (2006):
Resonanzraum Literatur. Polyphonie bei Friedrich Glauser.
München: Fink.
Campe, Rüdiger (1991):
"Die Schreibszene. Schreiben".
In: Gumbrecht, Hans Ulrich/Pfeiffer, K. Ludwig (Hrsg.):
Paradoxien, Dissonanzen, Zusammenbrüche. Situationen offener Epistemologie.
Frankfurt am Main. Suhrkamp: 759–772.
Deleuze, Gilles (1993/2000):
"Die Literatur und das Leben".
In: Deleuze, Gilles: Kritik und Klinik.
Frankfurt a. M.: 11–17.
Deleuze, Gilles (1994):
"Philosophie und Minorität".
In: Vogl, Joseph (ed.):
Gemeinschaften. Positionen zu einer Philosophie des Politischen.
Frankfurt am Main: 205–207.
Glauser, Friedrich (1915/16):
"Un poète philosophe. M. Frank Grandjean".
In: Echte, Bernhard/Papst, Manfred (Hrsgg.) (1992):
Mattos Puppentheater. Das erzählerische Werk. Band I: 1915–1929.
Zürich. Limmat: 264–271.
Glauser, Friedrich (1917/1919):
"Der Käfer".
In: Echte, Bernhard/Papst, Manfred (Hrsgg.) (1992):
Mattos Puppentheater. Das erzählerische Werk. Band I: 1915–1929.
Zürich. Limmat: 22–29.
Glauser, Friedrich (1936/37; 1995):
Matto regiert. Roman.
Hrgg. und mit einem Nachwort von Bernhard Echte.
Zürich. Limmat: 89–112.
Glauser, Friedrich (1937a):
"Schreiben...".
Zürcher Illustrierte 48, November 1937: 1514–1519.
Glauser, Friedrich (1937b):
"Schreiben...".
In: Echte, Bernhard/Papst, Manfred (Hrsgg.) (1993):
Gesprungenes Glas. Das erzählerische Werk. Band IV: 1937–1938.
Limmat Verlag: 78–84.
Glauser, Friedrich (1938):
"Ascona-Roman".
In: Echte, Bernhard/Papst, Manfred (Hrsgg.) (1993):
Gesprungenes Glas. Das erzählerische Werk. Band IV: 1937–1938.
Zürich. Limmat: 255–263.
Glauser, Friedrich (1988):
Briefe 1. 1911–1935.
Hrsgg. von Bernhard Echte und Manfred Papst.
Zürich: Arche.
Glauser, Friedrich (1991):
Briefe 2. 1935–1938.
Hrsgg. von Bernhard Echte.
Zürich: Arche.
Grandjean, Frank (o. J.):
L'Épopée du Solitaire. Poème.
Genève: Édition Atar.
Hay, Louis (1984):
"Die dritte Deimension der Literatur. Notizen zu einer 'critique génétique'".
Poetica. Zeitschrift für Sprach- und Literaturwissenschaft 16: 307–323.
Jakobson, Roman (1960):
"Linguistik und Poetik".
In: Holenstein, Elmar/Schelbert, Tarcisius (Hrsgg.) (1979):
Poetik. Ausgewählte Aufsätze 1921–1971.
Frankfurt am Main. Suhrkamp: 83–121.
Kittler, Friedrich A. (1988):
"Rhetorik der Macht und Macht der Rhetorik – Lohensteins 'Agrippina'".
In: Hans-Georg Pott (Hrsg.): Johann Christian Günther.
Paderborn/München/Wien/Zürich. Schöningh: 39−52.
Ludwig, Otto (1995):
"Integriertes und nicht-intergriertes Schreiben. Zu einer Theorie des Schreibens. Eine Skizze".
In: Baurmann, Jürgen/Weingarten, Rüdiger (Hrsgg.):
Schreiben. Prozesse, Prozeduren und Produkte.
Opladen. Westdeutscher Verlag: 273–287.
Schneider, Manfred (1981):
"Der Traum der Signora Paganini. Künstlerkarriere um 1800".
Literaturmagazin 14: 40–54.
Stingelin, Martin (2004):
"'Schreiben'. Einleitung".
In: Stingelin, Martin (Hrgs.):
'Mir ekelt vor diesem tintenklecksenden Säkulum'. Schreibszenen im Zeitalter der Manuskripte.
München: 7–21. (= Zur Genealogie des Schreibens 1).
Germanistik in der Schweiz.
Online-Zeitschrift der SAGG 5/2008
|